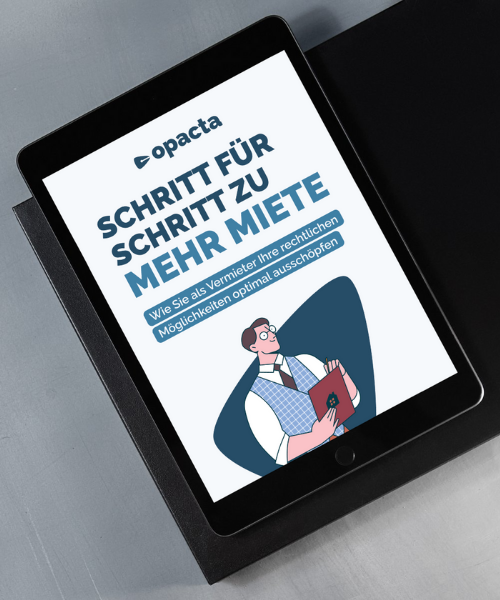Die Verjährung spielt im Mietrecht eine zentrale Rolle. Wer als Vermieter Ansprüche gegen den Mieter durchsetzen will, muss die gesetzlichen Fristen genau kennen. Werden diese versäumt, können Forderungen nicht mehr erfolgreich geltend gemacht werden. Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Verjährungsfristen, ihre gesetzlichen Grundlagen und praktische Beispiele.
Wie berechnet man Verjährungsfristen?
Damit Sie Verjährungsfristen richtig einordnen können, ist zunächst die Berechnung wichtig. Grundsätzlich beginnt die regelmäßige Verjährungsfrist mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und Sie als Vermieter Kenntnis davon erlangt haben oder ohne grobe Fahrlässigkeit hätten erlangen müssen (§ 199 BGB).
In besonderen Fällen, etwa bei Schadensersatz wegen Beschädigung der Mietsache, beginnt die Frist jedoch bereits mit Rückgabe der Wohnung.
Ansprüche verjähren immer mit Ablauf des letzten Tages der Frist, also um Mitternacht. Zu beachten ist außerdem, dass die Verjährung gehemmt (= pausiert) oder neu beginnen kann, etwa durch Klageerhebung, Mahnbescheid oder ernsthafte Verhandlungen zwischen den Parteien.
Reguläre Verjährung – 3 Jahre (§ 195 BGB)
Die dreijährige Regelverjährung ist der Standard im deutschen Zivilrecht und gilt auch für die meisten mietrechtlichen Ansprüche. Dazu gehören insbesondere offene Mietzahlungen oder Schadensersatzforderungen aus Vertragsverletzungen.
Für Vermieter bedeutet das, dass sie in aller Regel drei volle Kalenderjahre Zeit haben, um Forderungen rechtlich durchzusetzen.
Beginn der Frist ist der Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Vermieter von den relevanten Umständen Kenntnis hatte.
Damit wird eine gewisse Klarheit geschaffen, gleichzeitig aber auch Druck aufgebaut, innerhalb eines überschaubaren Zeitraums zu handeln.
Beispiel:
Der Mieter zahlt die Miete für Juli 2025 nicht. Der Anspruch verjährt mit Ablauf des 31.12.2028.
Betriebskostenabrechnung (§ 556 BGB, § 195 BGB)
Bei der Betriebskostenabrechnung ist zwischen der Abrechnungsfrist und der Verjährung zu unterscheiden. Der Vermieter muss innerhalb von zwölf Monaten nach Ende des Abrechnungszeitraums die Abrechnung erstellen und dem Mieter zustellen. Verpasst er diese Frist, kann er Nachforderungen nicht mehr geltend machen.
Liegt die Abrechnung rechtzeitig vor, unterliegt eine daraus resultierende Forderung jedoch der normalen Verjährung von drei Jahren.
Für Vermieter bedeutet das: Auch wenn die Abrechnung pünktlich erfolgt, muss die gerichtliche Durchsetzung (gemeint ist die rechtzeitige Klageerhebung) offener Nachzahlungen innerhalb dieser Frist erfolgen.
Beispiel:
Das Abrechnungsjahr 2025 endet am 31.12.2025. Die Abrechnung wird dem Mieter am 01.10.2026 zugestellt. Eine Nachforderung verjährt am 31.12.2029.
Kurze Verjährung für Schäden an der Mietsache (§ 548 BGB)
Besonders riskant für Vermieter ist die kurze Verjährungsfrist des § 548 BGB. Ansprüche wegen Veränderungen oder Verschlechterungen der Mietsache verjähren bereits innerhalb von sechs Monaten nach Rückgabe der Wohnung.
Die Frist läuft damit erheblich schneller ab als bei anderen Forderungen. Hinzu kommt, dass Vermieter oft erst nach Rückgabe der Mietsache Schäden feststellen, Gutachten einholen oder Handwerker beauftragen müssen. All diese Schritte verkürzen die ohnehin knappe Zeitspanne.
Außerdem ist zu unterscheiden, ob es sich um Schäden handelt, die im Rahmen der Schönheitsreparaturen beseitigt werden müssten, hier ist eine Fristsetzung erforderlich, oder ob es sich um Substanzschäden (Obhutspflichtverletzungen) handelt, die sofort einen Schadensersatzanspruch begründen.
Beispiel:
Die Wohnung wird am 31.08.2024 zurückgegeben. Etwaige Schadensersatzansprüche verjähren mit Ablauf des 28.02.2025.
Mieterhöhung und Zustimmungsklage (§ 558b BGB, § 242 BGB)
Verweigert oder ignoriert der Mieter ein Mieterhöhungsverlangen, bleibt dem Vermieter nur die Zustimmungsklage. Diese muss innerhalb von drei Monaten nach Ablauf der Zustimmungsfrist erhoben werden, sonst ist das Mieterhöhungsverlangen unwirksam.
Gleichzeitig gilt: Zahlt der Mieter die erhöhte Miete mehrere Monate lang vorbehaltlos, kann dies rechtlich als Zustimmung gewertet werden. Für Vermieter ist es deshalb entscheidend, die Fristen genau im Blick zu behalten und bei Untätigkeit des Mieters schnell zu reagieren.
Beispiel:
Das Mieterhöhungsverlangen wird am 10.04.2024 zugestellt. Die Zustimmungsfrist endet am 30.06.2024. Die Klage muss bis spätestens 30.09.2024 erhoben werden.
Eigenbedarfskündigung und Schadenersatz (§ 195 BGB)
Täuscht ein Vermieter Eigenbedarf vor und kündigt deswegen das Mietverhältnis, kann der Mieter Schadenersatz fordern. Auch dieser Anspruch unterliegt der dreijährigen Regelverjährung. Für Vermieter bedeutet dies: Ein solches Vorgehen kann nicht nur das Vertrauen zerstören, sondern auch noch Jahre später zu erheblichen finanziellen Forderungen führen.
Beispiel:
Das Mietverhältnis endet am 30.06.2025, der neue Mieter zieht bereits am 01.10.2025 ein. Eine Schadenersatzklage ist bis zum 31.12.2029 möglich.
Modernisierungsumlage (§ 195 BGB)
Nach einer Modernisierung kann der Vermieter die Miete erhöhen. Stellt sich jedoch heraus, dass die Mieterhöhung fehlerhaft berechnet wurde, hat der Mieter das Recht, zu viel gezahlte Beträge innerhalb von drei Jahren zurückzufordern. Auch hier gilt der Beginn mit dem Schluss des Jahres, in dem der Mieter den Fehler erkennt oder erkennen müsste.
Beispiel:
Die Miete wird ab 01.07.2024 erhöht, ein Fehler wird am 10.02.2026 festgestellt. Eine Rückforderung ist bis 31.12.2029 möglich.
Kündigungsfristen im Überblick (§ 573c BGB)
Neben Verjährungsfristen spielen Kündigungsfristen eine wichtige Rolle. Für Mieter beträgt die Frist immer drei Monate. Für Vermieter verlängert sich die Kündigungsfrist abhängig von der Dauer des Mietverhältnisses: nach fünf Jahren auf sechs Monate, nach acht Jahren auf neun Monate. Diese Staffelung schützt den Mieter, verpflichtet den Vermieter aber, langfristiger zu planen.
Beispiel:
Das Mietverhältnis beginnt am 01.08.2015. Der Vermieter kündigt am 10.04.2024. Das Mietverhältnis endet am 31.01.2025.
Fazit
Die Vielzahl unterschiedlicher Fristen macht deutlich, wie komplex das Thema Verjährung im Mietrecht ist. Während die dreijährige Regelverjährung für die meisten Ansprüche gilt, gibt es zahlreiche Sonderfristen, die für Vermieter große Bedeutung haben – allen voran die extrem kurze sechsmonatige Verjährung nach Rückgabe der Wohnung.
Wer als Vermieter auf der sicheren Seite sein will, sollte Fristen sorgfältig dokumentieren, frühzeitig handeln und im Zweifel rechtliche Beratung in Anspruch nehmen, um den Verlust von Ansprüchen zu vermeiden.