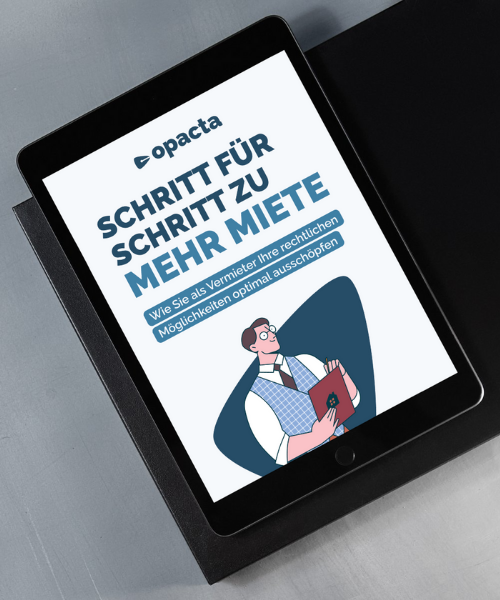Ein zuverlässiger Mieter ist für Vermieter das A und O. Bleiben Mietzahlungen aus, kann das nicht nur die eigene Liquidität belasten, sondern auch rechtliche und organisatorische Herausforderungen mit sich bringen. Ein konsequentes Forderungsmanagement beginnt jedoch nicht erst mit der ersten Mahnung, sondern bereits vor Abschluss des Mietvertrags.
In diesem Beitrag zeigen wir, wie Vermieter sich gegen Mietausfälle absichern können. Von der sorgfältigen Mieterauswahl über vertragliche Vereinbarungen bis hin zu versicherungstechnischen Lösungen.
Mieterauswahl: Bonitätsprüfung nicht vergessen
Viele spätere Zahlungsausfälle lassen sich bereits im Vorfeld durch eine sorgfältige Auswahl des Mieters vermeiden. Mietausfälle resultieren oft nicht nur aus plötzlichen Schicksalsschlägen, sondern aus mangelnder Zahlungsfähigkeit oder -willigkeit, die bereits bei Vertragsabschluss erkennbar gewesen wären. Deshalb sollten Vermieter bestimmte Unterlagen und Nachweise einholen und nicht aus Angst vor „Absprung“ des Interessenten darauf verzichten.
Mieterselbstauskunft
Ein zentrales Instrument zur Einschätzung der Zuverlässigkeit ist die Mieterselbstauskunft. Sie sollte nicht nur Namen und Kontaktdaten enthalten, sondern auch:
- Angaben zum Arbeitgeber und zur Dauer des Beschäftigungsverhältnisses,
- aktuelle Wohnanschrift und ggf. Referenz des Vorvermieters,
- Informationen über weitere im Haushalt lebende Personen,
- Selbsterklärungen zu laufenden Schulden oder offenen Mietforderungen, sowie
- Fragen zu bisherigen Mietausfällen, Insolvenzverfahren, die Abgabe eidesstattlicher Versicherungen und Einkommenspfändungen.
Die Selbstauskunft sollte schriftlich erfolgen und vom Mieter unterzeichnet sein. Werden falsche Angaben gemacht, kann dies später eine fristlose Kündigung rechtfertigen.
Nicht jede Frage ist erlaubt, und manche dürfen Vermieter nur stellen, wenn sie den Mietvertrag mit dem jeweiligen Mieter tatsächlich abschließen möchte. Lesen Sie für weitere Informationen, wann welche Fragen erlaubt sind diesen Beitrag: Mieterselbstauskunft.
Nachweise und Belege
Besonders wichtig sind:
- Gehaltsnachweise der letzten drei Monate oder ein aktueller Einkommenssteuerbescheid bei Selbstständigen,
- eine aktuelle Schufa-Auskunft (oder ein vergleichbares Bonitätszertifikat wie Bonify, Arvato etc.),
- bei Berufsanfängern oder befristeten Arbeitsverträgen: eine Kopie des Arbeitsvertrags.
Diese Unterlagen geben Aufschluss über die wirtschaftliche Stabilität des Mieters. Auch aus datenschutzrechtlicher Sicht ist die Abfrage zulässig sofern sie im Rahmen eines konkreten Mietinteresses erfolgt und die Daten vertraulich behandelt werden.
Als Orientierung sollte die Bruttomiete (Nettomiete und Betriebskostenvorauszahlung bzw. -pauschale) nicht mehr als 30 oder 40 % des Nettoeinkommens betragen.
MieterMapppe und BonitätsPass
Neben klassischen Bonitätsauskünften wie der SCHUFA gewinnen zunehmend digitale Lösungen an Bedeutung.
Plattformen wie itsmydata* ermöglichen Vermietern, Bonitätsinformationen, Identitätsnachweise und Einkommensbelege der Mietinteressenten strukturiert und DSGVO-konform einzusehen.
Über das Vermieterportal können Bewerber ihre Daten sicher freigeben, während der Vermieter schnell prüfen kann, ob negative Einträge vorliegen oder die Einkommensverhältnisse stabil sind.
Besonders praktisch ist die erweiterte Kontoanalyse (BonitätsPass+*), die mit Zustimmung des Mieters eine aktuelle Einschätzung der tatsächlichen Zahlungsfähigkeit erlaubt.
Solche digitalen Tools sparen Zeit, reduzieren Papierunterlagen und bieten eine verlässliche Entscheidungsgrundlage bei der Mieterauswahl.
*Affiliate Link
Persönlicher Eindruck
Neben Zahlen und Fakten zählt auch der persönliche Eindruck. Kommt der Interessent pünktlich zum Besichtigungstermin? Macht er widersprüchliche Angaben? Reagiert er ausweichend auf Fragen zur beruflichen Situation oder zur bisherigen Mietdauer? All das können Anzeichen dafür sein, dass erhöhte Vorsicht geboten ist.
Vertraglich absichern: Kaution, Bürgschaft und Versicherung
Auch wenn alle Unterlagen plausibel erscheinen, sollten Vermieter zusätzlich auf eine vertragliche Absicherung ihrer Ansprüche setzen. Denn auch ein solider Mieter kann arbeitslos werden, erkranken oder in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Kaution, Bürgschaft oder Versicherung bieten dann ein zusätzliches finanzielles Polster.
Mietkaution (§ 551 BGB)
Die klassische Barkaution darf maximal drei Monatskaltmieten betragen und ist bei Vertragsbeginn fällig. Auf Wunsch des Mieters auch in drei monatlichen Raten.
Vermieter sind verpflichtet, die Kaution zinsbringend und getrennt vom eigenen Vermögen anzulegen. Am Ende des Mietverhältnisses ist sie abzurechnen und ggf. anteilig zurückzuzahlen, es sei denn, offene Forderungen (z. B. Mietrückstände oder Betriebskostennachforderungen) stehen noch im Raum.
Die Kaution ist eine der wirksamsten Maßnahmen zur Absicherung gegen Mietausfall, da sie vom Vermieter ohne gerichtliches Verfahren zur Aufrechnung herangezogen werden kann. Verzichten Sie niemals auf eine Mietkaution und nutzen Sie die vollen drei Monatsmieten.
Bürgschaft eines Dritten
Gerade bei Mietinteressenten ohne ausreichendes Einkommen, etwa Studenten, Azubis oder Berufsanfängern, kann eine selbstschuldnerische Bürgschaft von Eltern oder anderen Personen mit guter Bonität sinnvoll sein.
Der Bürge verpflichtet sich, für alle Ansprüche aus dem Mietverhältnis zu haften, wenn der Mieter selbst nicht zahlungsfähig ist. Bei selbstschuldnerischen Bürgschaften können Sie den Bürgen sogar in Anspruch nehmen, wenn der Mieter eigentlich selbst zahlen könne (es ist kein vorheriges Vollstreckungsverfahren gegen den Mieter erforderlich). Wichtig ist eine klar formulierte Erklärung in Schriftform (§ 126 BGB), aus der sich ergibt, dass der Bürge auch auf die Einrede der Vorausklage verzichtet. In unseren Vermieterpaketen Plus und Premium sind Vorlagen für wirksame Bürgschaftserklärungen enthalten.
Die Bürgschaft kann auch zusätzlich zur Kaution vereinbart werden, muss aber bei Überschreitung der Drei-Monatsgrenze klar als freiwillige Zusatzsicherheit gekennzeichnet sein. Dies ist allerdings nur dann zulässig, wenn der Mieter diese Option von sich aus anbietet. Auch hierfür haben wir Vorlagen.
Alternativ kann bspw. bei Studenten, der Mietvertrag auch mit den Eltern abgeschlossen werden und vereinbart werden, dass der Sohn oder die Tochter dann tatsächlich in die Wohnung einzieht.
Mietkautionsversicherung
Immer beliebter wird die Mietkautionsversicherung. Statt eine Barkaution zu hinterlegen, zahlt der Mieter eine jährliche Prämie an eine Versicherung, die im Schadensfall für die Forderung des Vermieters einsteht.
Der Vorteil für den Vermieter ist, dass er eine Versicherung im Rücken hat, ohne sich um Anlagesicherheit, Zinsen oder Rückzahlungspflichten kümmern zu müssen. Der Nachteil überwiegt aber meist, da die Versicherung die Berechtigung des Anspruchs ausführlich prüft, was im Streitfall zu Verzögerungen führen kann.
Es ist aber natürlich besser, das Geld (als Kaution) direkt bei sich auf dem Konto zu haben. Denn dann muss im Zweifelsfall nicht der Vermieter klagen, sondern der Mieter die Rückgabe der (evtl. zu Unrecht einbehaltenen) Kaution geltend machen.
Technische und organisatorische Maßnahmen
Selbst mit einem zuverlässigen Mieter bleiben ein funktionierendes Mahnwesen und klare Abläufe bei Zahlungsstörungen wichtig. Schon einfache organisatorische Vorkehrungen können verhindern, dass Mietrückstände übersehen oder zu spät geltend gemacht werden.
SEPA-Lastschriftverfahren
Ein wirksames Mittel zur Vermeidung vergessener oder verspäteter Mietzahlungen ist das SEPA-Lastschriftverfahren. Damit wird die Miete monatlich automatisch vom Konto des Mieters abgebucht und der Vermieter muss nicht mehr auf Überweisungen warten.
Wichtig ist, dass das SEPA-Mandat schriftlich erteilt und mit einer Mandatsreferenznummer versehen wird. Es sollte Bestandteil des Mietvertrags oder als separate Anlage mitunterschrieben werden.
Nach außen wirkt das professionell und schafft auf Mieterseite oft zusätzliche Zahlungsdisziplin.
Alternativ sollte der Mieter zumindest zur Einrichtung eines Dauerauftrags aufgefordert werden.
Strukturiertes Mahnwesen
Wenn trotz aller Vorsichtsmaßnahmen eine Miete nicht oder verspätet eingeht, sollten Vermieter nicht zögern, sondern umgehend reagieren.
Ein klar strukturierter Ablauf empfiehlt sich:
- Erinnerung am 5. Werktag nach Fälligkeit (freundlich, ohne Drohung, evtl. per WhatsApp oder in einem kurzen Telefonat)
- Mahnung mit Fristsetzung, z. B. 7 Tage (schriftlich, per E-Mail oder Brief)
- Zweite Mahnung mit Kündigungsandrohung, wenn weiter keine Zahlung erfolgt
- Bei zwei ausstehenden Monatsmieten: außerordentliche Kündigung des Mietvertrags
Jeder Schritt sollte schriftlich dokumentiert und mit Datum versehen sein. Das hilft nicht nur im Streitfall, sondern signalisiert dem Mieter auch, dass der Vermieter professionell agiert und Forderungen konsequent durchsetzt.
Versicherungslösungen für Vermieter gegen Mietausfall
Neben vertraglichen Sicherheiten und organisatorischen Maßnahmen kann sich der Abschluss spezieller Versicherungen für Vermieter insbesondere bei höherem Investitionsvolumen oder mehreren Mietobjekten lohnen. Zwei Versicherungen sind hier besonders relevant.
Mietausfallversicherung
Die Mietausfallversicherung (umgangssprachlich auch Mietnomadenversicherung genannt) deckt Zahlungsausfälle ab, wenn der Mieter aus wirtschaftlichen Gründen z. B. bei Arbeitsplatzverlust oder Krankheit nicht mehr zahlen kann. Je nach Tarif können auch Rechtsverfolgungskosten, Räumungskosten und Sachschäden durch den Mieter versichert sein.
Mehr Informationen: Mietnomaden – Das Grauen eines jeden Vermieters.
Wichtig: Versicherer verlangen in der Regel eine Bonitätsprüfung des Mieters im Vorfeld und versichern keine bereits auffälligen oder zahlungssäumigen Mieter. Die Versicherungspolice kann also keine nachträgliche Lösung sein, sondern sollte vor Vertragsbeginn abgeschlossen werden.
Die jährlichen Kosten variieren je nach Objektgröße, Lage und Selbstbeteiligung, liegen aber oft im Bereich von 100 – 300 € pro Wohnung und können sich bereits bei einem einzigen Schadensfall rechnen.
Vermieter-Rechtsschutzversicherung
Ein ebenfalls empfehlenswerter Baustein ist eine Rechtsschutzversicherung speziell für Vermieter. Sie übernimmt Kosten für:
- gerichtliche Geltendmachung von Mietrückständen,
- Räumungsklagen und Zwangsvollstreckung,
- Streitigkeiten über Betriebskosten, Mängel oder Mietminderung, usw.
In vielen Fällen lassen sich Mietausfall- und Rechtsschutzversicherung in einer Kombipolice abschließen. Achten Sie hier auf den genauen Leistungsumfang, Wartezeiten und mögliche Ausschlüsse.
Eine unabhängige Beratung durch einen Versicherungsberater/-makler, der sich mit der Situation von Vermietern auskennt, kann nicht schaden.
Was tun bei Mietausfall? Reaktion bei Mietrückstand
Trotz aller Vorsorge bleibt das Risiko bestehen, dass Mietzahlungen etwa durch plötzliche Arbeitslosigkeit, Trennung, Krankheit oder schlicht fehlende Zahlungsmoral ausbleiben. In solchen Fällen ist es für Vermieter wichtig, besonnen, aber zügig zu handeln.
Mahnung
Zunächst sollte die ausstehende Miete angemahnt werden. Die Mahnung sollte folgende Punkte enthalten:
- genaue Bezifferung des Rückstands (z. B. „Miete März 2025: 980 €“),
- Frist zur Zahlung (z. B. 7 oder 10 Tage),
- Andeutung rechtlicher Schritte bei Nichtzahlung (z. B. Kündigung).
Die Mahnung kann auch per E-Mail erfolgen, sollte dann aber abgespeichert werden. Noch sicherer ist die Zustellung per Einwurf-Einschreiben oder mit Zeugen. Lesen Sie hierzu: Dokumente als Vermieter richtig zustellen.
Fristlose Kündigung
Bleibt der Mieter zwei Monatsmieten oder mehr im Rückstand, ist eine fristlose Kündigung ohne vorherige Abmahnung möglich (§ 543 Abs. 2 Nr. 3 BGB). Voraussetzung: Die Mietrückstände sind entweder über zwei Monate hinweg entstanden oder einmalig so hoch wie zwei Monatsmieten.
Eine hilfsweise ordentliche Kündigung sollte stets zusätzlich erklärt werden, um den Auszug auch bei nachträglicher Zahlung durchzusetzen.
Gerichtliches Vorgehen
Reagiert der Mieter weiterhin nicht, bleibt nur der Gang zum Amtsgericht:
- Zahlungsklage zur Geltendmachung offener Beträge
- Räumungsklage, ggf. mit einstweiliger Verfügung
- Zwangsvollstreckung bei Vorliegen eines Titels (Urteil im Räumungsprozess)
Gerade in Städten mit hoher Auslastung der Gerichte kann sich dieser Weg über Monate hinziehen. Umso wichtiger ist es, frühzeitig Maßnahmen zu ergreifen und alle Schritte zu dokumentieren.
Zusammenfassung & Fazit
Mietausfälle lassen sich zwar nie vollständig ausschließen, das Risiko lässt sich aber sehr reduzieren. Wer sich als Vermieter nicht allein auf den ersten Eindruck verlässt, sondern systematisch vorgeht, kann das Mietausfallsrisiko erheblich senken. Entscheidend ist dabei ein mehrstufiges Absicherungskonzept, das bereits vor Vertragsschluss ansetzt und bis zur konsequenten Durchsetzung offener Forderungen reicht.
Eine solide Bonitätsprüfung, eine durchdachte Vertragsgestaltung mit Kaution, Bürgschaft oder Versicherung sowie klare organisatorische Abläufe bilden das Fundament. Kommen dann noch technische Hilfsmittel wie das SEPA-Lastschriftverfahren oder eine gute Dokumentation hinzu, ist dies umso besser.
Und selbst wenn der Ernstfall eintritt, wer richtig vorbereitet ist, kann rechtlich fundiert und ohne Zeitverlust reagieren.