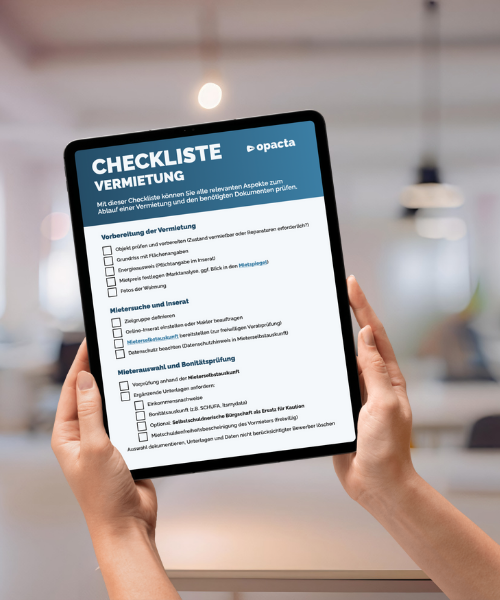Die meisten privaten Vermieter konzentrieren sich hauptsächlich auf den Kauf und die Vermietung von Wohnungen. Dennoch befinden sich in viele Mehrfamilienhäuser im Erdgeschoss Gewerbeflächen wie Restaurants, Bäckereien oder Kioske. Wer ganze Mehrfamilienhäuser kaufen möchte, kann also auch „unfreiwillig“ zum Gewerberaumvermieter werden. Und auch wer mit dem Gedanken spielt, direkt in Gewerbeflächen zu investieren, sollte die Unterscheidung zwischen Wohnraum- und Gewerbemiete kennen.
Beide Mietarten unterliegen unterschiedlichen rechtlichen Rahmenbedingungen und Regelungen. Während das Wohnraummietrecht den Schutz des Mieters im Fokus hat und die Vertragsfreiheit stark eingeschränkt wird, bieten Gewerbemietverträge mehr Freiheiten und Flexibilität bei der Vertragsgestaltung.
Dieser Blogbeitrag erklärt, wie eine Wohnraummiete von einer Gewerbemiete abgegrenzt wird und was die wesentlichen Unterschiede der Gestaltungsmöglichkeiten der jeweiligen Mietverträge sind.
Abgrenzung Wohnraum- vs. Gewerbemiete
Ein Mietverhältnis über Wohnraum liegt vor, wenn Räumlichkeiten zu Wohnzwecken vermietet werden. Hierbei ist auf den vereinbarten Zweck abzustellen und zu prüfen, ob die Räumlichkeiten dem privaten Aufenthalt und zur Befriedigung des Wohnbedürfnisses des Mieters überlassen werden sollen. Der Mieter muss sich jedoch nicht selbst in der Wohnung aufhalten. So können beispielsweise auch Eltern eine Wohnung für ihr studierendes Kind anmieten.
Eine Geschäftsraummiete (oder auch Gewerbemiete) liegt vor, wenn die Räumlichkeiten nicht für Wohnzwecke genutzt werden sollen. Ist hierbei nichts über die Art des Gewerbes vereinbart, so dürfen die Räume grundsätzlich für alle legalen Geschäfte genutzt werden. Allerdings muss beachtet werden, dass nur ein solches Gewerbe ausgeübt werden darf, das üblicherweise in vergleichbaren Räumen ausgeübt wird. In einer „Wohnung“ in einem Mehrfamilienhaus darf beispielsweise je nach Stadtbezirk nicht der Prostitution nachgegangen werden. Gleiches gilt für Tätigkeiten, die viel Lärm, Gerüche oder Schmutz verursachen. Eine Industrieproduktion ist in einem Mehrfamiliengebäude also logischerweise nicht möglich.
Gerade in Zeiten von Homeoffice und Remote Work ist zu beachten, dass auch die Ausübung dieser Tätigkeiten in der Wohnung grundsätzlich als Wohnen betrachtet wird und keine Gewerberaummiete vorliegt. Gleiches gilt auch, wenn beispielsweise ein Buchautor oder Journalist dauerhaft aus einem eingerichteten Büroraum in der Wohnung arbeitet.
Was sind die Unterschiede von Wohnraum- und Gewerbemiete
Die Hauptunterschiede zwischen Wohnraummietverträgen und Gewerbemietverträgen bestehen in dem Ausmaß der Gestaltungsfreiheit der getroffenen Vereinbarungen. Bei Wohnraummietverträgen dürfen viele gesetzliche Mindeststandards nicht umgangen werden, weil die Mieter vom Gesetzgeber als schutzbedürftiger gesehen werden als Gewerbetreibende oder Unternehmen. Bei Gewerbemietverträgen hingegen können die Regelungen weitgehend frei vereinbart werden.
Zunächst gilt bei der Vermietung von Wohnraum das Bestellerprinzip. Das bedeutet, dass der Vermieter die Maklergebühren zahlen muss, wenn er den Makler beauftragt bzw. bestellt. Bei Gewerbevermietungen gibt es keine Regelungen, wer die Provision zahlt. Oft zahlen Mieter und Vermieter beide eine Provision an den Makler. Die Höhe der Provision kann hier z. B. von der Mietdauer abhängen.
Die Miethöhe bei Gewerbeimmobilien ist grundsätzlich frei verhandelbar. Bei Wohnraum muss die Miete sich an der ortsüblichen Vergleichsmiete orientieren (Mietpreisbremse).
Ein weiterer wesentlicher Unterschied besteht in der Möglichkeit der Befristung des Mietverhältnisses. Im Wohnraummietverhältnis ist eine Befristung nur unter den engen Voraussetzungen des § 575 BGB möglich, während ein Gewerbemietvertrag grundsätzlich ohne Weiteres befristet werden kann. Gewerbemietverträge sind oft auf 3, 5 oder 10 Jahre befristet.
Auch die Vereinbarung einer Kaution ist für das Wohnraummietverhältnis stark reguliert. Die Höhe der Kaution ist auf maximal drei Monatskaltmieten gedeckelt und der Mieter hat das Recht, die Kaution in Raten zu zahlen. Im Gewerbemietvertrag kann die Kaution hingegen grundsätzlich frei vereinbart werden.
Ein weiterer erheblicher Unterschied liegt darin, welche Betriebs- und Nebenkosten auf den Mieter umgelegt werden können. Im Wohnraummietverhältnis dürfen nur die in § 2 der Betriebskostenverordnung (BetrKV) aufgezählten Kosten auf den Mieter umgelegt werden. Im Gewerbemietverhältnis hingegen können die Betriebskosten erheblich ausgeweitet werden, sofern dies ausdrücklich vereinbart wird.
Die Übertragung von Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an gemeinschaftlich genutzten Flächen und Anlagen ist im Wohnraummietverhältnis ausgeschlossen. Im Gewerbemietverhältnis kann dies individuell vereinbart werden, wobei in Formularverträgen (AGB) eine Obergrenze geregelt sein muss. Diese beträgt in der Praxis meist 5-10 % der Jahresnettokaltmiete.
Erhebliche Unterschiede bestehen auch beim Kündigungsrecht des Vermieters. Ein Gewerbemietvertrag kann ohne Angabe von Gründen ordentlich fristgemäß gekündigt werden, während beim Wohnraummietvertrag auch eine ordentliche Kündigung nur aus bestimmten Gründen möglich ist. Auch verlängern sich hier die Kündigungsfristen mit Dauer des Mietverhältnisses zugunsten des Mieters.
Bei Mietrückständen kann sowohl bei Wohnraummietverhältnissen als auch bei Gewerbemietverhältnissen gekündigt werden. Eine Nachzahlung der Mietschulden lässt den Kündigungsgrund jedoch nur bei Wohnraummietverhältnissen entfallen.
Kommt es im Rahmen des Mietvertrages zu Rechtsstreitigkeiten, so ist bei einem Wohnraummietvertrag immer das Amtsgericht zuständig, in dessen Bezirk die Wohnung liegt. Bei Gewerbemieten kann dies vertraglich geregelt werden.
Zusammenfassung
| Wohnraummiete | Gewerbemiete | |
| Maklergebühren | Bestellerprinzip: der Auftraggeber des Maklers muss die Provision bezahlen | frei vereinbar, normalerweise werden die Provisionen geteilt |
| Miethöhe | Stark reguliert, Mietpreisbremse | Verhandelbar |
| Befristung des Mietverhältnisses | § 575 BGB ist zu beachten | Grundsätzlich frei vereinbar |
| Kaution | Maximal 3 Monatsmieten, Mieter hat Recht zur Ratenzahlung | Verhandelbar |
| Betriebs- und Nebenkosten | Nur die Betriebskosten nach § 2 BetrKV | Weitergehende Möglichkeiten der Umlegung von Betriebskosten |
| Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an gemeinschaftlich genutzten Flächen und Anlagen | Nicht umlegbar | Verhandelbar |
| Kündigungsrecht | Stark eingeschränkt | Fristgemäß ohne Grund möglich |
| Rechtsstreitigkeiten / örtlicher Gerichtsstand | Amtsgericht in dessen Bezirk die Wohnung liegt | Gerichtsstandvereinbarungen möglich |