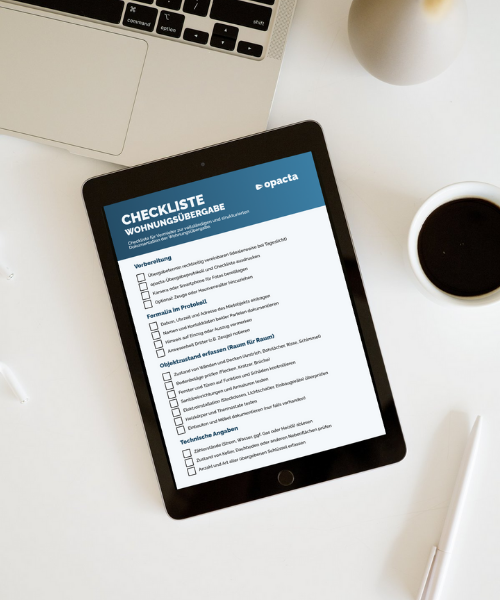Viele Mietverträge enthalten Klauseln, die bei genauer rechtlicher Prüfung unwirksam sind, ohne dass Vermieter dies wissen. Als Folge können Vermieter sich im Streitfall nicht auf diese Regelungen berufen. Der Mieter darf die Klausel ignorieren.
Die Rechtsprechung, insbesondere des Bundesgerichtshofs (BGH), hat in den letzten Jahren zahlreiche typische Vertragsformulierungen gekippt, etwa zu Schönheitsreparaturen, Kündigungsfristen oder Besichtigungsrechten. Im Folgenden finden Sie einen systematischen Überblick über die 17 häufigsten nichtigen Vertragsklauseln in Mietverträgen.
Rechtsfolgen von unwirksamen Klauseln
Ist eine Klausel im Mietvertrag unwirksam entfaltet sie keine rechtliche Wirkung. Das bedeutet, dass der Mieter an die Klausel nicht gebunden ist.
Die betreffende Regelung wird dann quasi ersatzlos gestrichen und es gilt die gesetzliche Regelung an ihre Stelle (z. B. § 535 BGB zur Instandhaltungspflicht, § 573c BGB zur Kündigungsfrist).
Viele Vertragsklauseln in Mietverträgen sind Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) im Sinne der §§ 305 ff. BGB. AGB sind vorformulierte Vertragsbedingungen, die eine Vertragspartei (hier in der Regel der Vermieter) der anderen Partei bei Vertragsschluss stellt.
Sie unterliegen einer strengen gerichtlichen Kontrolle. Nach § 307 BGB sind solche Klauseln unwirksam, wenn sie den Vertragspartner – hier den Mieter – „unangemessen benachteiligen“. Maßstab für diese Beurteilung sind insbesondere gesetzliche Leitbilder sowie die Interessen beider Vertragsparteien.
Wichtig: Eine sog. geltungserhaltende Reduktion, also das „Herunterkürzen“ einer unwirksamen Klausel auf das gerade noch rechtlich zulässige Maß, ist ausgeschlossen.
Beispiel: Ist eine Kleinreparaturklausel unwirksam, weil sie 150 € pro Reparatur vorsieht, wird sie nicht auf 100 € reduziert, sondern ist insgesamt nichtig.
1. Haftungsausschluss des Vermieters
Ein vollständiger Haftungsausschluss des Vermieters für Mängel an der Mietsache ist unzulässig. Nach § 536a Abs. 1 BGB haftet der Vermieter für Schäden, die auf einem Mangel beruhen, den er zu vertreten hat oder der bereits bei Vertragsschluss bestand.
Zwar kann die verschuldensunabhängige Haftung für anfängliche Mängel vertraglich ausgeschlossen werden. Die verschuldensabhängige Haftung ist jedoch nicht dispositiv (= nicht abdingbar), ein entsprechender Ausschluss wäre nach § 307 BGB unwirksam, weil er den Mieter unangemessen benachteiligt.
Auch für Fälle, in denen der Vormieter nicht rechtzeitig auszieht und die Wohnung deshalb nicht wie vereinbart übergeben werden kann, bleibt der Vermieter grundsätzlich verantwortlich (§ 536a Abs. 3 BGB). Klauseln, die diese gesetzliche Verantwortung einschränken oder auf den Mieter verlagern wollen, sind ebenfalls nichtig.
Vermieter sollten daher auf pauschale Formulierungen wie „jegliche Haftung ist ausgeschlossen“ verzichten.
2. Schönheitsreparaturen mit starren Fristen oder konkreten Vorgaben
Klauseln, die starre Fristen für Schönheitsreparaturen vorsehen, sind regelmäßig nach § 307 BGB unwirksam. Dies betrifft zum Beispiel Formulierungen wie:
„Der Mieter hat Schönheitsreparaturen in Küche, Bad und WC alle drei Jahre, in den übrigen Räumen alle fünf Jahre durchzuführen.“
Der Bundesgerichtshof hat wiederholt entschieden, dass solche Klauseln den Mieter unangemessen benachteiligen, weil sie ihn auch dann zur Renovierung verpflichten, wenn kein tatsächlicher Renovierungsbedarf besteht (z. B. BGH, Urteil vom 5. April 2006 – VIII ZR 163/05).
Ebenso unzulässig sind konkrete Vorgaben zur Ausführung, etwa zur Farbwahl („nur weiße Wände“) oder zur Verwendung bestimmter Produkte („Farbe von Alpina“). Diese greifen nach der Rechtsprechung unzulässig in die Gestaltungsfreiheit des Mieters ein und sind daher nichtig.
Zulässig sind hingegen flexible Klauseln, die Renovierungen „in der Regel“, „im Allgemeinen“ oder „bei Bedarf“ vorsehen. Auch diese unterliegen einer genauen Prüfung und müssen sich am tatsächlichen Zustand der Wohnung orientieren.
Fazit für Vermieter: Verwenden Sie keine festen Fristen und verzichten Sie auf konkrete Ausführungsanweisungen, da Sie sonst riskieren, dass die gesamte Schönheitsreparaturklausel unwirksam ist.
Weitere Informationen: Schönheitsreparaturen – Tipps für Vermieter.
3. Pflicht zum Einsatz von Handwerkern
In manchen Mietverträgen finden sich Klauseln, wonach der Mieter Schönheitsreparaturen ausschließlich durch einen Fachbetrieb oder einen Handwerker ausführen lassen muss. Eine solche Vorgabe ist unangemessen benachteiligend und daher nach § 307 BGB unwirksam.
Der Bundesgerichtshof hat klargestellt, dass der Mieter grundsätzlich frei darin ist, wer die Schönheitsreparaturen durchführt, solange sie fachgerecht erfolgen. Es darf ihm nicht vorgeschrieben werden, einen professionellen Maler oder Handwerker zu beauftragen, wenn er die Arbeiten ebenso sorgfältig selbst erledigen kann. Auch eine mittelbare Verpflichtung durch Formulierungen wie „durch einen Fachmann“ oder „in Handwerkerqualität“ kann zur Unwirksamkeit führen.
Fazit für Vermieter: Sie dürfen keine zwingende Handwerkerbindung im Vertrag aufnehmen. Zulässig ist allenfalls eine Formulierung, die auf eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten abstellt.
4. Endrenovierungspflicht bei Auszug
Eine häufig verwendete Klausel verpflichtet den Mieter, unabhängig vom Zustand der Wohnung oder davon, ob bei Einzug renoviert wurde, zur Renovierung beim Auszug. Solche Endrenovierungsklauseln sind unwirksam, wenn sie pauschal und ohne Rücksicht auf den tatsächlichen Abnutzungsgrad formuliert sind.
Besonders kritisch sind Klauseln, die eine Endrenovierung verlangen, obwohl der Mieter eine unrenovierte Wohnung übernommen hat. In solchen Fällen wäre der Mieter schlechter gestellt als der Vormieter, was ein Verstoß gegen das Gebot der angemessenen Interessenabwägung nach § 307 BGB darstellt.
Beispiel:
„Der Mieter verpflichtet sich, die Wohnung bei Auszug vollständig renoviert zu übergeben.“
Diese Regelung ist nur dann wirksam, wenn die Wohnung bei Einzug in renoviertem Zustand übergeben wurde und die Klausel keine starren Vorgaben enthält. Aber auch dann bedarf es einer sorgfältigen und differenzierten Formulierung, die Sie besser einem Mietrechtsanwalt überlassen.
Vermieter sollten daher grundsätzlich keine Endrenovierungspflichten aufnehmen, sondern im Zweifel auf flexible Schönheitsreparaturregelungen setzen, die an den tatsächlichen Zustand der Wohnung anknüpfen.
5. Abgeltungsklauseln für Auszug
Abgeltungsklauseln sollen den Mieter dazu verpflichten, anteilig Kosten für Schönheitsreparaturen zu übernehmen, wenn der Renovierungszyklus zwar noch nicht vollständig abgelaufen ist, aber bereits ein gewisser Abnutzungsgrad vorliegt.
Beispiel:
„Zieht der Mieter vor Ablauf der üblichen Renovierungsintervalle aus, so hat er anteilige Renovierungskosten zu tragen.“
Solche Klauseln sind nach ständiger Rechtsprechung des BGH unwirksam, da sie den Mieter unangemessen benachteiligen. Sie verpflichten zur Zahlung, ohne dass eine konkrete Renovierungspflicht zu einem bestimmten Zeitpunkt feststeht und greifen damit unzulässig in die Interessenlage des Mieters ein. Zudem besteht bei unklaren oder pauschalen Abgeltungsklauseln die Gefahr, dass sie auch dann greifen würden, wenn tatsächliche keine Renovierungsbedürftigkeit vorliegt.
Fazit für Vermieter: Abgeltungsklauseln sind rechtlich riskant. Es ist sicherer, auf sie ganz zu verzichten.
6. Vorsicht bei Kleinreparaturklauseln
Grundsätzlich kann im Mietvertrag vereinbart werden, dass der Mieter die Kosten für kleinere Instandhaltungsmaßnahmen, sog. Kleinreparaturen, selbst trägt. Eine solche Kleinreparaturklauseln ist unter engen Voraussetzungen zulässig. Jedoch muss die Klausel sowohl eine Einzelobergrenze als auch eine Jahresobergrenze enthalten.
Beispiel:
„Der Mieter trägt die Kosten für alle Kleinreparaturen bis zu 500 €.“
Nach gefestigter Rechtsprechung dürfen folgende Grenzwerte nicht überschritten werden:
- 60 bis 120 € je Einzelmaßnahme,
- 6 bis 8 % der Jahreskaltmiete als Jahresgesamtgrenze.
Enthält die Klausel keine Begrenzung, eine zu hohe Grenze oder ist sie zu unbestimmt formuliert, ist sie insgesamt unwirksam.
Ebenso unzulässig ist es, Kleinreparaturen auf Teile der Mietsache zu erstrecken, die nicht dem unmittelbaren und häufigen Zugriff des Mieters unterliegen, etwa Rohrleitungen oder Elektroinstallationen in der Wand.
Auch sog. Selbstvornahmeklauseln sind unwirksam. Der Vermieter muss die Handwerker für die Reparatur beauftragen und ist selbst der Vertragspartner des Handwerksunternehmens. Es ist nicht zulässig den Mieter dazu zu verpflichten, die Reparaturen selbst durchzuführen.
Empfehlung für Vermieter: Verwenden Sie nur geprüfte Formulierungen mit klaren Obergrenzen und beschränken Sie die Kleinreparaturpflicht auf Gegenstände im täglichen Zugriff des Mieters.
Weitere Informationen: Kleinreparaturen und Kleinreparaturklauseln.
7. Pflicht zur privaten Haftpflichtversicherung
Manche Vermieter nehmen in den Vertrag eine Klausel auf, wonach der Mieter verpflichtet ist, eine private Haftpflichtversicherung abzuschließen und dem Vermieter einen Nachweis darüber vorzulegen. Diese Klausel ist unzulässig.
Denn es besteht keine gesetzliche Pflicht zum Abschluss einer solchen Versicherung. Der Mieter darf selbst entscheiden, ob und wie er sich gegen private Haftungsrisiken absichert. Eine Klausel, die ihn vertraglich dazu verpflichtet, stellt eine unangemessene Benachteiligung dar und ist daher gemäß § 307 BGB unwirksam.
Auch der Hinweis, dass andere Mietinteressenten bevorzugt behandelt werden, wenn sie eine Versicherung vorlegen, ändert nichts an der Unzulässigkeit einer solchen Verpflichtung im Vertrag.
Hinweis für Vermieter: Sie dürfen den Abschluss einer Haftpflichtversicherung weder verlangen noch zur Bedingung des Mietverhältnisses machen. Allerdings kann dem Mieter empfohlen werden, auf freiwilliger Basis, eine Haftpflichtversicherung abzuschließen.

8. Wohnflächenangabe mit „circa“ oder Einschränkungen
Ein häufiger Streitpunkt ist die Größe der vermieteten Wohnung. Manche Mietverträge enthalten Formulierungen wie:
„Die Wohnfläche beträgt circa 75 m². Diese Angabe dient nicht zur Festlegung des Mietgegenstands.“
Solche Klauseln sind laut ständiger BGH-Rechtsprechung unwirksam, wenn sie dem Mieter die Möglichkeit nehmen sollen, bei einer erheblichen Abweichung der tatsächlichen Fläche die Miete zu mindern. Weicht die tatsächliche Wohnfläche um mehr als 10 % von der vertraglich vereinbarten Fläche nach unten ab, liegt ein Mangel der Mietsache vor (BGH, Urteil vom 10. März 2010 – VIII ZR 144/09) und der Mieter ist zur Mietminderung berechtigt.
Der Versuch, durch „circa“-Angaben oder Einschränkungen wie „wegen möglicher Messfehler nicht verbindlich“ das Minderungsrecht auszuschließen, ist rechtlich nicht haltbar. Eine solche Formulierung schützt den Vermieter nicht vor Mietminderungen.
Empfehlung für Vermieter: Geben Sie die Wohnfläche korrekt und möglichst exakt an oder verzichten Sie ganz auf eine Flächenangabe im Vertrag, wenn keine verlässliche Vermessung vorliegt. Circa-Angaben sind grundsätzlich unbedenklich, bieten jedoch keinen Nutzen, wenn die tatsächliche Wohnfläche um mehr als 10 % abweicht. Informieren Sie sich, wie die Wohnfläche korrekt berechnet wird: Wohnfläche Mietwohnung berechnen.
9. Unzulässige Kündigungsfrist für Mieter
Ein Mietvertrag darf für den Mieter keine längere Kündigungsfrist als gesetzlich vorgesehen enthalten. Nach § 573c Abs. 1 S. 1 BGB kann der Mieter unabhängig von der Dauer des Mietverhältnisses jederzeit mit einer Frist von drei Monaten kündigen.
Klauseln wie
„Die Kündigungsfrist für den Mieter beträgt sechs Monate“
sind unwirksam, da sie gegen das gesetzliche Leitbild verstoßen und den Mieter unangemessen benachteiligen.
Zulässig ist lediglich ein beidseitiger Kündigungsverzicht von maximal vier Jahren.
Fazit für Vermieter: Halten Sie sich bei der Kündigungsfrist für Mieter stets an die gesetzlich vorgeschriebene Frist von drei Monaten.
Weitere Informationen: Außerordentliche Kündigung für Vermieter, Eigenbedarfskündigung.
10. Kündigung durch Vermieter ohne Grund
In manchen älteren Mietverträgen findet sich noch eine Klausel, wonach der Vermieter das Mietverhältnis jederzeit ohne Angabe von Gründen kündigen kann, zum Beispiel:
„Der Vermieter kann das Mietverhältnis mit einer Frist von drei Monaten kündigen, ohne dass es eines besonderen Grundes bedarf.“
Solche Klauseln sind unwirksam, weil sie gegen § 573 Abs. 1 S. 1 BGB verstoßen. Danach darf der Vermieter nur kündigen, wenn er ein berechtigtes Interesse an der Beendigung des Mietverhältnisses hat. Ein solches liegt bspw. bei Eigenbedarfs, nachhaltiger Vertragsverletzung des Mieters oder bei einer Verwertungskündigung vor.
Ein Kündigungsrecht ohne Grund ist gesetzlich nicht vorgesehen und kann daher nicht wirksam vereinbart werden. Im Streitfall kann sich der Mieter mit der Folge, dass die Kündigung unwirksam ist, auf die gesetzliche Regelung berufen.
11. Kündigungsverzicht über vier Jahre
Ein Kündigungsverzicht kann im Mietvertrag wirksam vereinbart werden, sofern er beidseitig und für maximal vier Jahre gilt. Längere Zeiträume sind laut BGH wegen unangemessener Benachteiligung des Mieters nach § 307 BGB unwirksam (BGH, Urteil vom 8. Dezember 2010 – VIII ZR 86/10).
Unwirksam sind auch Konstruktionen, die zwar einen vierjährigen Verzicht vorsehen, aber faktisch zu einer Bindung über mehr als vier Jahre führen, etwa durch Kombination mit der dreimonatigen Kündigungsfrist:
„Das Mietverhältnis kann frühestens zum Ablauf von vier Jahren mit einer Frist von drei Monaten gekündigt werden.“
Solche Klauseln führen zu einer Bindung von vier Jahren und drei Monaten und sind damit insgesamt nicht zulässig.
Tipp für Vermieter: Wenn Sie einen Kündigungsverzicht vereinbaren wollen, achten Sie darauf, dass er beidseitig, klar formuliert und auf maximal vier Jahre begrenzt ist. Sonst gilt das gesetzliche Kündigungsrecht. Da hier viele Sonderfälle greifen, finden Sie hier weitere Informationen: Kündigungsausschluss wirksam vereinbaren.
12. Befristung ohne zulässigen Grund
Ein Zeitmietvertrag, also ein Mietvertrag mit einem festen Enddatum, ist nur wirksam, wenn im Vertrag ein gesetzlich anerkannter Befristungsgrund angegeben wird und dieser auch vorliegt. Fehlt dieser, ist die Befristung gemäß § 575 Abs. 1 BGB unwirksam und das Mietverhältnis gilt automatisch als unbefristet.
Zulässige Befristungsgründe sind:
- geplanter Eigenbedarf des Vermieters oder naher Angehöriger,
- beabsichtigte bauliche Veränderungen, die die Fortsetzung des Mietverhältnisses erheblich erschweren würden (z. B. Abriss, Umbau),
- geplante Vermietung an einen zur Dienstleistung verpflichteten Dritten (z. B. Hausmeister, Werkdienstwohnung).
Unzulässig ist dagegen eine Formulierung wie:
„Das Mietverhältnis beginnt am 01.01.2025 und endet am 31.12.2025.“
sofern keine weitere Erläuterung enthalten ist.
Ein fehlender oder nur pauschal gehaltener Hinweis auf den Befristungsgrund genügt nicht. Der Grund muss bei Vertragsabschluss schriftlich genannt und konkret benannt werden. Wird dies versäumt, kann der Mieter das Mietverhältnis jederzeit mit der gesetzlichen Frist kündigen und es liegt rechtlich ein unbefristeter Vertrag vor.
Tipp für Vermieter: Verwenden Sie Zeitmietverträge nur dann, wenn Sie den Befristungsgrund klar benennen können und dokumentieren Sie diesen umfassend.
13. Allgemeines Zutrittsrecht für Vermieter
Ein pauschales Recht des Vermieters, die Wohnung jederzeit zu betreten oder zu besichtigen, ist unzulässig. Der Bundesgerichtshof hat mehrfach klargestellt, dass solche Klauseln gegen das Persönlichkeitsrecht des Mieters verstoßen unwirksam sind (z. B. BGH, Urteil vom 4. Juni 2014 – VIII ZR 289/13).
Unwirksam sind insbesondere Formulierungen wie:
„Der Vermieter ist jederzeit berechtigt, die Wohnung zu besichtigen.“
oder
„Der Mieter gestattet dem Vermieter regelmäßig Zutritt zur Überprüfung des Wohnungszustands.“
Ein Zutrittsrecht besteht nur in konkret begründeten Einzelfällen, etwa bei berechtigtem Verdacht auf Mängel, zur Schadensverhütung oder zur Weitervermietung bzw. einem potenziellen Verkauf der Immobilie. Auch dann muss der Vermieter den Besuch aber rechtzeitig ankündigen. Ein generelles Besichtigungsrecht gibt es im deutschen Mietrecht nicht.
Empfehlung für Vermieter: Verwenden Sie nur konkrete, anlassbezogene Regelungen für Besichtigungen und kündigen Sie diese stets schriftlich und mit ausreichender Frist an.
Weitere Informationen: Wohnung betreten als Vermieter.
14. Generelles Verbot von Haustieren
Eine Klausel, die jegliche Tierhaltung pauschal verbietet, ist unwirksam. Das gilt insbesondere für Formulierungen wie:
„Das Halten von Haustieren in der Wohnung ist grundsätzlich untersagt.“
Nach ständiger BGH-Rechtsprechung stellt ein solcher pauschaler Ausschluss eine unangemessene Benachteiligung dar, da er auch übliche Kleintiere wie Hamster, Meerschweinchen oder Wellensittiche betrifft, deren Haltung grundsätzlich erlaubt ist.
Zwar kann die Haltung größerer Tiere wie Hunde oder Katzen von der Zustimmung des Vermieters abhängig gemacht werden. Diese Zustimmung darf jedoch nicht willkürlich verweigert werden, sondern muss auf sachlichen Gründen, wie etwa Überbelegung, Allergien anderer Hausbewohner oder Haltung in ungeeigneter Wohnungslage, beruhen.
Empfehlung für Vermieter: Verwenden Sie differenzierte Klauseln, die die Haltung von Kleintieren zulassen und für größere Tiere eine Zustimmungs- oder Mitteilungspflicht vorsehen.
Weitere Informationen: Haustiere – Rechte von Vermietern.
15. Musizieren generell untersagt
Ein vollständiges Verbot des Musizierens in der Wohnung ist unzulässig, da es den Mieter in seinem Recht auf vertragsgemäßen Gebrauch der Mietsache zu sehreinschränkt.
Klauseln wie
„Musizieren ist in der Wohnung grundsätzlich nicht erlaubt.“
sind daher nach § 307 BGB unwirksam.
Musizieren gehört grundsätzlich zur erlaubten Nutzung einer Mietwohnung, sofern die üblichen Ruhezeiten eingehalten werden. Ein generelles Verbot wäre nur dann zulässig, wenn durch die konkrete Nutzung eine erhebliche Störung des Hausfriedens zu befürchten ist. Eine solche Störung liegt aber nur bei übermäßiger Lautstärke oder dauerhaftem Üben mit besonders lärmintensiven Instrumenten in hellhörigen Gebäuden vor. Auch in solchen Fällen darf die Einschränkung jedoch nicht pauschal, sondern muss konkret und einzelfallbezogen geregelt sein.
Fazit für Vermieter: Musizieren darf vertraglich eingeschränkt, aber nicht generell verboten werden. Regeln Sie das Musizieren im Haus in der Hausordnung.
16. Besuchseinschränkungen
Auch Klauseln, die den Empfang von Besuch zeitlich begrenzen oder einschränken, sind unwirksam.
Formulierungen wie
„Besucher sind nur bis 21 Uhr erlaubt.“
verstoßen gegen das Recht des Mieters auf freie Entfaltung der Persönlichkeit und auf sozialen Kontakt in der eigenen Wohnung.
Der Mieter ist berechtigt, jederzeit Besuch zu empfangen, solange dadurch nicht die berechtigten Interessen der Hausgemeinschaft beeinträchtigt werden. Der Vermieter darf Besuch weder verbieten noch beschränken, es sei denn, das Verhalten der Besucher führt zu konkreten Störungen.
Hinweis: Wird ein Besuch jedoch auf Dauer angelegt oder handelt es sich faktisch um eine Mitnutzung oder Untervermietung, kann eine Zustimmungspflicht des Vermieters erforderlich sein.
Empfehlung für Vermieter: Verzichten Sie auf Besuchsklauseln und regeln Sie stattdessen Verhaltenspflichten in die Hausordnung.
17. Rauchverbot in der Wohnung
Ein formularmäßiges Rauchverbot in der Mietwohnung ist unwirksam, denn Rauchen gehört zum vertragsgemäßen Gebrauch der Mietsache.
Formulierungen wie
„Rauchen in der Wohnung ist verboten.“
sind daher nicht durchsetzbar.
Der Vermieter darf jedoch in gemeinschaftlichen Flächen wie Hausflur, Treppenhaus oder Waschküche das Rauchen untersagen.
In der gemieteten Wohnung selbst kann das Rauchen weder untersagt noch sanktioniert werden, solange keine konkreten Schäden entstehen oder andere Mieter erheblich beeinträchtigt werden. Auch ein erhöhtes Abnutzungspotenzial (z. B. Nikotinflecken) rechtfertigt kein Rauchverbot.
Tipp für Vermieter: Verzichten Sie auf Rauchverbote in der Wohnung, setzen Sie stattdessen auf individuelle Vereinbarungen außerhalb des Mietvertrags und/oder auf klare Regeln für Gemeinschaftsräume in der Hausordnung.
Weitere Informationen: Rauchverbot im Mietvertrag.
Was bringen salvatorische Klauseln in Mietverträgen?
Auch wenn eine oder mehrere Klauseln im Mietvertrag unwirksam sind, bedeutet das nicht, dass der gesamte Vertrag nichtig ist. In der Regel bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam, soweit sich die Unwirksamkeit nicht auf den Vertragskern auswirkt.
Zur zusätzlichen rechtlichen Absicherung enthalten Mietverträge fast immer eine sog. salvatorische Klausel.
Beispiel:
„Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder nach Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen unberührt.“
Diese Klausel stellt klar, dass der Vertrag auch bei einzelnen rechtlich fehlerhaften Klauseln insgesamt bestehen bleibt.
Wichtig: Auch eine salvatorische Klausel führt nicht zu einer geltungserhaltenden Reduktion. Sie schützt nur den Gesamtvertrag, nicht den Inhalt der unwirksamen Klausel selbst.
Tipp für Vermieter: Eine salvatorische Klausel gehört zum Standard jedes Mietvertrags und sollte nicht fehlen.
Tipps für Vermieter, um unwirksame Klauseln zu vermeiden
Damit Sie verlässliche Mietverträge abschließen, sollten Sie folgende Grundregeln beachten:
- Verwenden Sie nur aktuelle Musterverträge, die sich an der aktuellen BGH-Rechtsprechung orientieren.
- Vermeiden Sie pauschale oder starre Formulierungen, z. B. bei Schönheitsreparaturen, Fristen oder Zutrittsrechten.
- Setzen Sie auf gesetzlich anerkannte Standards und formulieren Sie Klauseln transparent und nachvollziehbar.
- Dokumentieren Sie Individualvereinbarungen schriftlich, wenn von Standardregeln abgewichen werden soll.
- Holen Sie sich im Zweifel rechtlichen Rat vor Vertragsabschluss ein, das kann spätere Konflikte und finanzielle Nachteile verhindern.
- Oder: nutzen Sie einfach die Mietvertragsvorlagen von opacta!