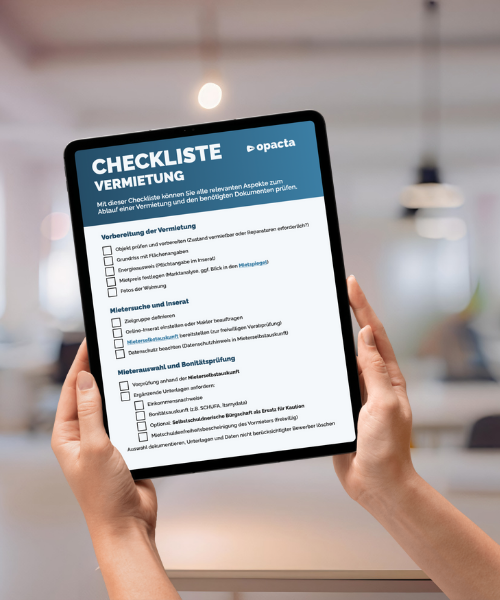Viele Vermieter verlassen sich bei der Sicherung offener Forderungen ausschließlich auf die Mietkaution. Dabei gibt es ein weiteres gesetzlich vorgesehenes Sicherungsmittel: das Vermieterpfandrecht.
Es greift automatisch, wenn bestimmte Voraussetzungen vorliegen, wird in der Praxis aber selten genutzt. Dabei kann es insbesondere bei säumigen Mietern ein wertvolles Druckmittel darstellen, sofern Vermieter die rechtlichen Grenzen und Anforderungen genau kennen.
Was ist das Vermieterpfandrecht?
Das Vermieterpfandrecht nach § 562 BGB ist ein gesetzlich normiertes Sicherungsrecht des Vermieters, das ihm unter bestimmten Voraussetzungen ein Pfandrecht an den vom Mieter in die Mieträume eingebrachten, beweglichen Sachen einräumt.
Es dient der Absicherung von Forderungen aus dem Mietverhältnis, insbesondere rückständiger Miete, Betriebskosten oder Schadensersatzansprüchen des Vermieters.
Im Gegensatz zur Mietkaution entsteht das Vermieterpfandrecht automatisch kraft Gesetzes, ohne dass es einer vertraglichen Vereinbarung bedarf.
Es ist dabei nicht auf Wohnraummietverhältnisse beschränkt, sondern gilt gleichermaßen im Gewerberaummietrecht. Voraussetzung ist stets, dass die betreffenden Gegenstände dem Mieter gehören, sich in den Mieträumen befinden und pfändbar sind.
Das Pfandrecht ermöglicht es dem Vermieter, zur Sicherung seiner Ansprüche notfalls auch auf die Verwertung dieser Gegenstände hinzuwirken.
Voraussetzungen für das Vermieterpfandrecht
Das gesetzliche Vermieterpfandrecht ist ein besitzloses gesetzliches Pfandrecht, das automatisch entsteht, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:
- Bestehende Forderung aus dem Mietverhältnis: Die Forderung (also ein Anspruch des Vermieters gegen den Mieter) muss aus dem Mietvertrag folgen. Erfasst sind beispielsweise Mietrückstände, Betriebskosten(-nachzahlungen), Schadensersatz wegen Beschädigung der Mietsache oder Nutzungsentschädigung nach Beendigung des Mietverhältnisses. Rein private Forderungen des Vermieters (z. B. Darlehen an den Mieter) sind nicht umfasst.
- Einbringen in die Mieträume: Das Pfandrecht entsteht nur an Sachen, die der Mieter mit seinem Willen in die Mietsache eingebracht hat (z.B. Möbel). Dazu zählen auch im Mietobjekt hergestellte oder zwischengelagerte Gegenstände.
- Eigentum des Mieters: Nur Gegenstände, die sich im Alleineigentum oder (bei Miteigentum) anteiligen Eigentum des Mieters befinden, unterliegen dem Pfandrecht. An Leasingobjekten, geliehenen oder sicherungsübereigneten Gegenstände besteht grundsätzlich kein Vermieterpfandrecht.
Was darf gepfändet werden?
Das Vermieterpfandrecht bezieht sich ausschließlich auf bewegliche Sachen, die sich im Eigentum des Mieters befinden und mit dessen Willen in die Mieträume eingebracht wurden. Gepfändet werden dürfen daher grundsätzlich:
- Möbel
- Elektrogeräte
- Schmuck
- Teppiche
- sonstige wertvolle Gegenstände, sofern sie sich innerhalb der Mietsache befinden.
Dürfen Anwartschaftsrechte gepfändet werden?
Auch Anwartschaftsrechte an unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Gegenständen können vom Vermieterpfandrecht erfasst sein, sofern die Gegenstände eingebracht wurden.
Das Anwartschaftsrecht ist ein rechtlicher „Vorläufer“ des Eigentums. Das volle Recht (z. B. Eigentum) ist noch nicht ganz entstanden, aber der rechtliche Weg dorthin ist schon so weit fortgeschritten, dass der Inhaber es nicht mehr einfach verlieren kann. Nur noch wenige Voraussetzungen müssen erfüllt werden dann „wandelt sich“ das Anwartschaftsrecht in das volle Recht.
Ein Mieter kauft einen Schrank im Möbelhaus auf Raten. Im Kaufvertrag steht, dass das Möbelhaus Eigentümer bleibt, bis der letzte Teil des Kaufpreises bezahlt ist, ein sogenannter Eigentumsvorbehalt. Solange der Mieter noch nicht alle Raten bezahlt hat, ist er also noch nicht Eigentümer des Schranks, hat aber ein Anwartschaftsrecht, welches pfändbar ist.
Was darf nicht gepfändet werden?
Ausgeschlossen vom Vermieterpfandrecht sind sämtliche unpfändbaren Gegenstände im Sinne des § 811 ZPO. Das Gesetz schützt insbesondere solche Sachen, die für eine menschenwürdige Lebensführung oder die Ausübung des Berufs erforderlich sind.
Auch Gegenstände, die nicht im Eigentum des Mieters stehen, sind nicht pfändbar.
Im Einzelnen sind vom Pfandrecht ausgenommen:
- Haushaltsgegenstände des täglichen Bedarfs, wie
Bett, Kleidung, Waschmaschine, Kühlschrank - Arbeitsmittel, die der Erwerbstätigkeit dienen (z. B. Laptop bei Selbständigen oder Werkzeug bei Handwerkern)
- Bargeld bis zur gesetzlichen Pfändungsfreigrenze
- Haustiere sowie persönliche Dinge wie
Trauringe, Tagebücher, private Aufzeichnungen oder Orden - Gegenstände, die nicht im Eigentum des Mieters stehen, etwa
geleaste, geliehene oder unter Eigentumsvorbehalt stehende Sachen - Eigentum von Mitbewohnern, Ehe- oder Lebenspartnern, sofern diese nicht Mieter im rechtlichen Sinne sind
Der Vermieter trägt die Beweislast für die Pfändbarkeit. Der Mieter muss hingegen nachweisen, wenn ein Gegenstand unpfändbar ist oder in fremdem Eigentum steht.
Wie wird das Vermieterpfandrecht geltend gemacht?
Das Pfandrecht entsteht automatisch mit Einbringung der pfändbaren Sachen. Es bedarf keiner besonderen Vereinbarung im Mietvertrag. Für die Ausübung gilt:
- Die Geltendmachung kann formlos, beispielsweise durch mündliche Erklärung gegenüber dem Mieter, erfolgen. Aus Gründen der Beweissicherung empfiehlt sich jedoch eine schriftliche Mitteilung mit konkreter Benennung der Forderung und Hinweis auf das Vermieterpfandrecht, idealerweise mit Zugangsnachweis (z. B. Einwurf-Einschreiben; Wie stelle ich Dokumente als Vermieter an Mieter zu?).
- Die Ausübung des Pfandrechts bedeutet, dass der Vermieter vom Mieter verlangt, die pfändbaren Gegenstände nicht zu entfernen. Der Vermieter ist jedoch nicht berechtigt, selbstständig in die Wohnung einzudringen oder Gegenstände an sich zu nehmen.
- Eine gerichtliche Durchsetzung ist nur auf Grundlage eines vollstreckbaren Titels (z. B. eines Urteils mit Titel) möglich. Erst danach darf ein Gerichtsvollzieher beauftragt werden, die Sachen zu sichern und ggf. öffentlich zu versteigern.
Zu beachten ist zudem, dass der Vermieter dem Mieter in der Regel eine angemessene Frist zur Begleichung der Forderung setzen sollte, bevor weitere Schritte unternommen werden. Bei Gewerberaummietverhältnissen gelten teils abweichende Anforderungen, etwa in Bezug auf gelagerte Handelsware oder Vorbehaltsgut.
Grenzen, Risiken und typische Fehler bei der Ausübung des Vermieterpfandrechts
Die Geltendmachung des Vermieterpfandrechts unterliegt strengen gesetzlichen Voraussetzungen. Wird es unrechtmäßig oder unvorsichtig ausgeübt, drohen erhebliche rechtliche Konsequenzen. Zu den häufigsten Risiken und Fehlerquellen gehören:
Verbotene Eigenmacht
Der Vermieter darf keinesfalls ohne gerichtlichen Titel die Wohnung betreten oder eigenmächtig Gegenstände in Besitz nehmen. Eine solche Selbsthilfe ist unzulässig und stellt nach ständiger Rechtsprechung eine verbotene Eigenmacht dar.
Neben zivilrechtlichen Schadensersatzansprüchen kann auch eine strafrechtliche Relevanz gegeben sein, insbesondere wegen Hausfriedensbruchs gemäß § 123 StGB.
Selbst das Auswechseln des Türschlosses oder das eigenmächtige Räumen der Wohnung („kalte Räumung“) ist unzulässig und kann erhebliche Haftungsrisiken für den Vermieter begründen.
Pfandkehr durch den Mieter
Wird das Pfandrecht ordnungsgemäß ausgeübt, darf der Mieter die betroffenen Gegenstände nicht einfach aus der Wohnung entfernen. Tut er es doch, begeht er eine sogenannte Pfandkehr nach § 289 StGB, die mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe geahndet werden kann.
Voraussetzung ist, dass der Mieter von der Ausübung des Pfandrechts Kenntnis hatte und dennoch pfändbare Sachen heimlich oder bewusst beiseiteschafft.
Erlöschen des Pfandrechts durch Untätigkeit
Wenn der Vermieter davon Kenntnis erlangt, dass pfändbare Gegenstände aus der Mietsache entfernt wurden, ist rasches Handeln erforderlich. Widerspricht der Vermieter nicht, erlischt das Pfandrecht unwiderruflich, vgl. § 562a BGB.
Der Widerspruch sollte schriftlich erfolgen. Wer untätig bleibt, verliert seine Sicherung.
Fehleinschätzung der Pfändbarkeit
Ein häufiger Fehler besteht darin, unpfändbare Gegenstände zu sichern oder verwerten zu wollen, etwa Haushaltsgeräte, Arbeitsmittel oder Eigentum Dritter.
Auch dies kann Schadensersatzansprüche des Mieters auslösen. Der Vermieter trägt die Beweislast dafür, dass die gepfändeten Gegenstände tatsächlich dem Mieter gehören und pfändbar sind.
Wann erlischt das Vermieterpfandrecht?
Das Vermieterpfandrecht erlischt grundsätzlich, wenn die pfändbaren Gegenstände aus den Mieträumen entfernt werden. Dies gilt jedoch nur dann, wenn die Entfernung mit Wissen des Vermieters erfolgt und dieser nicht binnen eines Monats widerspricht (§ 562a BGB).
Erfolgt die Entfernung hingegen heimlich oder gegen den ausdrücklichen Willen des Vermieters, bleibt das Pfandrecht bestehen und der Vermieter kann die Rückschaffung oder Herausgabe verlangen.
Ebenfalls erlischt das Pfandrecht, wenn der Vermieter der Entfernung ausdrücklich zustimmt oder wenn die entfernten Gegenstände im Rahmen üblicher Lebens- oder Geschäftsvorgänge aus der Wohnung gebracht werden (z. B. Mitnahme eines Laptops zur Arbeit oder Warenumschlag bei Gewerberaummiete), sofern die verbleibenden Gegenstände zur Sicherung ausreichen.
Ein weiterer Erlöschensgrund liegt vor, wenn das Anwartschaftsrecht an einem unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Gegenstand nachträglich entfällt.
In jedem Fall ist der Vermieter gut beraten, etwaige Entfernungen zeitnah zu dokumentieren und gegebenenfalls gerichtliche Schritte einzuleiten, um den Bestand des Pfandrechts zu sichern.
Zusammenfassung
Das Vermieterpfandrecht gemäß § 562 BGB ist ein gesetzlich vorgesehenes Sicherungsrecht, das dem Vermieter ermöglicht, offene Forderungen aus dem Mietverhältnis durch ein Pfandrecht an den in die Mieträume eingebrachten, beweglichen Sachen des Mieters abzusichern. Es entsteht automatisch kraft Gesetzes und gilt sowohl im Wohnraum- als auch im Gewerbemietrecht.
Voraussetzung ist, dass die betreffende Forderung aus dem Mietverhältnis stammt, die Sache sich im Eigentum des Mieters befindet und tatsächlich in die Mieträume eingebracht wurde.
Gepfändet werden dürfen nur verwertbare, nicht unpfändbare Gegenstände. Unzulässig ist die Pfändung von Haushaltsgegenständen des täglichen Bedarfs, Arbeitsmitteln oder Eigentum Dritter.
Die Geltendmachung des Pfandrechts ist formfrei möglich, setzt zur tatsächlichen Durchsetzung aber einen vollstreckbaren Titel und den Einsatz eines Gerichtsvollziehers voraus.
Bei unsachgemäßer Ausübung, etwa durch eigenmächtiges Betreten der Wohnung, drohen Schadensersatz- und Strafverfahren. Das Pfandrecht kann außerdem erlöschen, etwa wenn der Vermieter die Entfernung von Sachen duldet.