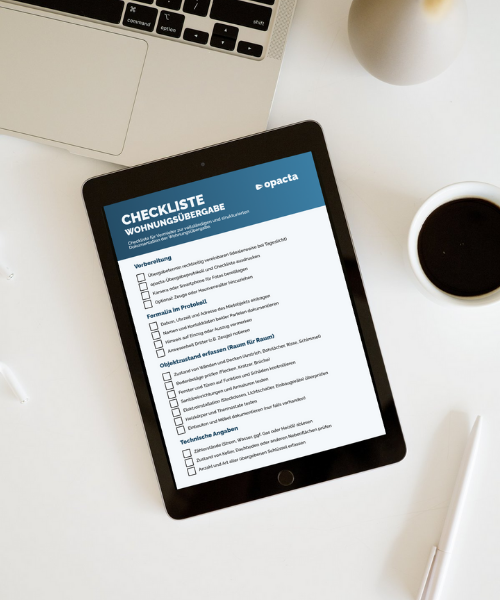Die Vermietung an minderjährige Mieter ist in der Praxis eher selten, kommt aber durchaus vor, etwa wenn Auszubildende, Studenten oder Schüler erstmals eine eigene Wohnung beziehen möchten. Für Vermieter stellt sich dabei die Frage, ob ein Mietvertrag mit einer noch nicht volljährigen Person überhaupt wirksam geschlossen werden kann und welche rechtlichen Besonderheiten gelten.
Da Minderjährige im deutschen Zivilrecht nicht uneingeschränkt geschäftsfähig sind, ergeben sich für Vermieter spezielle Risiken. Diese betreffen insbesondere die Wirksamkeit des Vertrags, die Haftung und die finanzielle Absicherung.
Rechtliche Grundlagen
Die Wirksamkeit von Mietverträgen mit Minderjährigen hängt unmittelbar von deren Geschäftsfähigkeit ab. Diese ist in den §§ 104 bis 113 BGB geregelt und bildet den Kern der rechtlichen Beurteilung:
- Geschäftsunfähigkeit: Kinder unter 7 Jahren sind nach § 104 Nr. 1 BGB geschäftsunfähig. Ein von ihnen abgeschlossener Mietvertrag ist nach § 105 Abs. 1 BGB nichtig. Der Vermieter kann daraus keinerlei Ansprüche herleiten.
- Beschränkte Geschäftsfähigkeit: Minderjährige zwischen dem 7. und 18. Lebensjahr sind nach § 106 BGB beschränkt geschäftsfähig. Sie können zwar Rechtsgeschäfte abschließen, diese sind jedoch grundsätzlich von der Einwilligung (§ 107 BGB) oder der nachträglichen Genehmigung (§ 108 BGB) ihrer gesetzlichen Vertreter (= beide), meist der Eltern, abhängig.
- Volle Geschäftsfähigkeit: Mit Vollendung des 18. Lebensjahres tritt volle Geschäftsfähigkeit ein. Ab diesem Zeitpunkt kann die betreffende Person selbstständig Mietverträge schließen, ohne dass Eltern oder gesetzliche Vertreter eingebunden werden müssen.
Besondere gesetzliche Ausnahmen erweitern die Handlungsfreiheit Minderjähriger:
- Taschengeldparagraph: Hat der Minderjährige die Miete aus eigenen Mitteln gezahlt, die ihm zur freien Verfügung überlassen wurden, kann ein Vertrag wirksam sein. Da es sich bei Mietverhältnissen jedoch um langfristige Verpflichtungen handelt, greift der Taschengeldparagraph (§ 110 BGB) hier in der Regel nicht.
- Dienst- oder Arbeitsverhältnis: Ist ein Jugendlicher von seinen Eltern zur Aufnahme eines Arbeitsverhältnisses ermächtigt, darf er nach § 113 BGB auch eigenständig eine Wohnung am Arbeitsort anmieten – allerdings nur im Rahmen seiner finanziellen Leistungsfähigkeit. Aufgrund erheblicher Rechtsunsicherheit sollten sich Vermieter hierauf nicht verlassen.
Für Vermieter folgt daraus: Ohne eine nachweisbare Zustimmung der Eltern oder eine gesetzliche Ausnahme besteht stets das Risiko, dass der Vertrag schwebend unwirksam ist. Bis zur Genehmigung können Vermieter keine Ansprüche auf Mietzahlung oder Vertragsdurchführung geltend machen. Dies wird dann relevant, wenn der Minderjährige als Mieter seine monatliche Miete nicht wie vereinbart überweist.
Abschluss eines Mietvertrags mit Minderjährigen
Der praktische Abschluss eines Mietvertrages mit einem minderjährigen Mieter erfordert besondere Vorsicht:
Einwilligung der Eltern vor Vertragsunterzeichnung
Grundsätzlich sollte die Einwilligung der Eltern vor Vertragsschluss schriftlich vorliegen. Sie kann im Mietvertrag selbst erfolgen (Unterschrift der Eltern für die Einwilligung) oder in einer gesonderten Erklärung beigefügt werden.
Die Eltern vertreten sie ihr Kind grundsätzlich gemeinsam (§ 1629 Abs. 1 BGB). Daher sollte im Zweifel immer die Unterschrift beider Elternteile eingeholt werden.
Bei geschiedenen oder getrenntlebenden Eltern muss geprüft werden, wem das Sorgerecht zusteht. Nur der tatsächlich Sorgeberechtigte darf wirksam für das Kind handeln.
Achtung: Eine stillschweigende Zustimmung bspw. durch Anwesenheit der Eltern beim Einzug reicht nach der Rechtsprechung nicht aus.
Nachträgliche Genehmigung der Eltern
Hat der Minderjährige den Vertrag ohne Einwilligung abgeschlossen, bleibt er schwebend unwirksam. Der Vermieter kann die Eltern zur Genehmigung auffordern. Erfolgt innerhalb von zwei Wochen keine Genehmigung, gilt diese als verweigert.
Vermieter sollten eine solche Aufforderung daher stets nachweisbar zustellen, um klare Rechtsfolgen herbeizuführen.
Langfristige Mietverhältnisse
Soll der Mietvertrag über das 18. Lebensjahr hinaus bestehen und den Minderjährigen noch auf Jahre hinaus binden, reicht die Zustimmung der Eltern nicht mehr aus. Bedarf es zusätzlich einer Genehmigung durch das Familiengericht. Ohne diese ist der Vertrag unwirksam. In der Praxis betrifft dies vor allem unbefristete oder mehrjährige Mietverträge, die vor dem 18. Geburtstag abgeschlossen werden.
Kein Schutz des Vermieters bei Unkenntnis
Vermieter tragen das volle Risiko, wenn sie die Minderjährigkeit übersehen oder sich nicht nachweisen lassen, dass eine Einwilligung vorliegt. Auch wenn der Mieter fälschlicherweise behauptet, volljährig zu sein, bleibt der Vertrag ohne Zustimmung bzw. nachträgliche Genehmigung der gesetzlichen Vertreter (Eltern) unwirksam. Deshalb sollte der Vermieter sich den Personalausweis vorlegen lassen.
Praxisempfehlung: In allen Fällen, in denen ein Mietvertrag mit einem Minderjährigen geschlossen werden soll, ist es für den Vermieter unerlässlich, die Eltern entweder als Mitmieter oder als Bürgen einzubinden. Dies schafft nicht nur Rechtssicherheit, sondern schützt auch vor Zahlungsausfällen.
Welche Rolle spielen die Eltern des Minderjährigen?
Da Minderjährige nur beschränkt geschäftsfähig sind, kommt den Eltern als gesetzlichen Vertretern eine Schlüsselrolle zu. Für Vermieter gibt es zwei typische Wege, die Eltern rechtssicher in das Mietverhältnis einzubinden.
Eltern als Mitmieter
Werden die Eltern gemeinsam mit dem minderjährigen Kind als Vertragspartner aufgenommen, entsteht ein voll wirksames Mietverhältnis mit gesamtschuldnerischer Haftung des Minderjährigen und seiner Eltern.
Das bedeutet, sowohl Eltern als auch Kind haften gemeinsam für die Mietzahlungen und die Erfüllung sämtlicher Pflichten. Für Vermieter ist dies die rechtlich sicherste Variante, weil die Eltern als voll Geschäftsfähige uneingeschränkt verpflichtet werden und meist über eine bessere Bonität verfügen.
Eltern als Bürgen
Alternativ können die Eltern eine selbstschuldnerische Bürgschaft übernehmen. In diesem Fall schließen Vermieter und Kind den Mietvertrag, die Eltern sichern jedoch alle Verpflichtungen des Kindes ab. Der Vermieter kann sich im Fall von Mietrückständen unmittelbar an die Eltern wenden, ohne vorher erfolglos beim Kind zu vollstrecken.
Vorteil der Bürgschaft ist, dass der Vertrag formal mit dem minderjährigen Mieter geschlossen wird. Dies kann sinnvoll sein, wenn der Minderjährige selbstständig wohnen soll, aber die Eltern für die finanzielle Absicherung sorgen.
Praxisempfehlung für Vermieter
Vermieter sollten – insbesondere bei unklarer Bonität des minderjährigen Mieters – die Eltern nach Möglichkeit als Mitmieter oder Hauptmieter in den Vertrag aufnehmen. Dies verschafft mehr Sicherheit als eine reine Bürgschaft.
Finanzielle Sicherheiten bei der Vermietung an Minderjährige
Mietkaution
Auch bei minderjährigen Mietern kann eine Kaution nach § 551 BGB vereinbart werden. Sie darf maximal drei Nettokaltmieten betragen und muss auf einem insolvenzfesten Konto angelegt werden.
Problematisch ist, dass Minderjährige oft nicht über eigenes Vermögen verfügen. In der Praxis zahlen deshalb regelmäßig die Eltern die Kaution. Wichtig ist, dass die Herkunft der Mittel eindeutig dokumentiert wird, um Streitigkeiten über die Zuordnung zu vermeiden.
In Ausnahmefällen kann auch der Minderjährige selbst die Kaution stellen, etwa wenn er eigenes Einkommen aus einer Ausbildung hat. Dann gilt, dass die Kaution aus Mitteln stammen muss, die ihm zur freien Verfügung überlassen wurden.
Unterstützung durch Jugendhilfeträger
Gerade in Fällen des betreuten Wohnens oder wenn Jugendliche aus schwierigen Familienverhältnissen stammen, kann das Jugendamt oder ein anderer Jugendhilfeträger die Kaution übernehmen. Möglich ist entweder eine direkte Zahlung oder eine Kautionsbürgschaft.
Für Vermieter bietet dies eine zusätzliche Absicherung, da öffentliche Stellen regelmäßig solvent sind. In der Vertragsgestaltung sollte dann aber ausdrücklich festgelegt werden, wie und von wem die Kaution gestellt wird.
Finanzierung der laufenden Miete
Neben der Kaution stellt sich für Vermieter die Frage nach der laufenden Zahlungsfähigkeit. Typische Konstellationen sind:
- Unterhaltszahlungen der Eltern – regelmäßig die Hauptquelle für die Mietzahlung.
- Einkünfte aus Ausbildungsvergütung – können in Höhe und Beständigkeit schwanken.
- Staatliche Unterstützung – etwa BAföG oder Berufsausbildungsbeihilfe.
Sonstige Besonderheiten im Mietverhältnis mit Minderjährigen
Auch nach Abschluss eines Mietvertrages mit einem minderjährigen Mieter gibt es für Vermieter einige Besonderheiten zu beachten. Diese betreffen vor allem Untervermietung, Kündigung und Haftung.
Untervermietung durch einen Minderjährigen
Möchte der Mieter einen Teil der Wohnung untervermieten, benötigt er die Zustimmung des Vermieters. Dies gilt auch bei minderjährigen Mietern.
- Eine Einwilligung der Eltern ist in diesem Fall regelmäßig erforderlich, da es sich um eine weitere rechtsgeschäftliche Erklärung handelt, die im Zusammenhang mit dem Mietvertrag steht.
- Vermieter sollten die Zustimmung nur schriftlich(§ 126 BGB) erteilen und dabei konkrete Bedingungen festlegen (z. B. Begrenzung auf bestimmte Personen oder Räume).
- Verweigert der Vermieter die Zustimmung ohne berechtigtes Interesse, kann der Mieter ein außerordentliches Kündigungsrecht haben.
Kündigung und Kündigungsschutz
Auch bei einem Minderjährigen gelten die allgemeinen Vorschriften zu Kündigung und Kündigungsschutz.
- Kündigung durch den Vermieter: Eine Kündigung muss stets auch den gesetzlichen Vertretern des Minderjährigen zugestellt werden. Die Kündigungsgründe müssen den gesetzlichen Anforderungen entsprechen, z. B. Eigenbedarf oder Kündigung wegen Zahlungsverzug.
- Besonderer Schutz: Minderjährige Mieter sind genauso geschützt wie volljährige. Eine Kündigung kann daher nicht leichter durchgesetzt werden, nur weil der Vertragspartner noch nicht volljährig ist.
- Genehmigung durch die Eltern: Eine Kündigungserklärung des minderjährigen Mieters ist nur wirksam, wenn auch die Eltern zustimmen. Ein bloßes Kündigungsschreiben des Minderjährigen reicht nicht aus.
Hinweis für Vermieter: Bei Zweifeln an der Wirksamkeit einer Kündigung sollte unbedingt rechtlicher Rat eingeholt werden, um formale Fehler zu vermeiden.
Haftung und Schadensersatz
Ein weiterer wichtiger Punkt betrifft die Haftung des Mieters für Schäden in der Wohnung.
- Minderjährige Mieter: Nach § 828 BGB haften Minderjährige nur eingeschränkt. Kinder unter 7 Jahren sind deliktsunfähig, Kinder zwischen 7 und 17 Jahren haften nur, wenn sie die nötige Einsicht in die Tragweite ihres Handelns hatten.
- Einbeziehung der Eltern: Sind die Eltern Mitmieter oder Bürgen, können Vermieter Schäden unmittelbar gegenüber den Eltern geltend machen. Dies schafft eine wesentlich bessere Durchsetzbarkeit von Ansprüchen.
- Praktische Probleme: In vielen Fällen wird die Frage nach der Einsichtsfähigkeit des Minderjährigen im Streitfall schwierig zu beurteilen sein. Dies kann zu Beweisschwierigkeiten führen.
Praxisempfehlung: Vermieter sollten schon bei Vertragsabschluss darauf achten, dass Schadensersatzansprüche klar geregelt sind und die Eltern entweder als Mitmieter oder als Bürgen haften. Zudem kann eine private Haftpflichtversicherung der Eltern hilfreich sein, um Risiken abzusichern. Der Vermieter kann Mieter allerdings nicht zum Abschluss einer Haftpflichtversicherung verpflichten. Eine Empfehlung schadet jedoch nicht.
Rechtsfolgen bei unwirksamen Mietverträgen
Kommt ein Mietvertrag mit einem Minderjährigen ohne die erforderliche Zustimmung zustande, ist er schwebend unwirksam (§ 108 BGB). Für Vermieter ergeben sich daraus erhebliche Risiken.
- Keine Ansprüche auf Mietzahlungen: Solange die Eltern den Vertrag nicht genehmigen, besteht kein Anspruch auf die vereinbarte Miete. Der Vermieter trägt also das volle Risiko, dass der Vertrag unwirksam bleibt.
- Widerrufsrecht des Vermieters: Bis zur Genehmigung können Vermieter den Vertrag nach § 109 BGB selbst widerrufen, etwa um die Wohnung schnell anderweitig zu vermieten. Dies ist jedoch ausgeschlossen, wenn der Vermieter wusste, dass die Zustimmung der Eltern fehlt.
- Bereicherungsansprüche: Hat der Minderjährige die Wohnung bereits genutzt, kommt unter Umständen ein Anspruch aus ungerechtfertigter Bereicherung (§ 812 BGB) in Betracht. Voraussetzung ist, dass der Minderjährige noch „bereichert“ ist, also tatsächlich einen Vermögensvorteil behalten hat. In der Praxis sind diese Ansprüche oft schwer durchzusetzen.
- Herausgabeanspruch (§ 985 BGB): Stellt sich heraus, dass keine Zustimmung vorliegt, kann der Vermieter die sofortige Räumung der Wohnung verlangen.
Fazit: Ohne Zustimmung der Eltern steht der Vermieter mit leeren Händen da. Daher ist die rechtssichere Gestaltung bei Vertragsabschluss entscheidend, um solche Situationen zu vermeiden.
Praxisempfehlungen für Vermieter
Wer an minderjährige Mieter vermieten möchte, sollte besondere Vorsicht walten lassen. Die folgenden Maßnahmen helfen, rechtliche Fallstricke zu vermeiden:
- Altersprüfung: Lassen Sie sich vor Vertragsabschluss stets den Personalausweis vorlegen und dokumentieren Sie das Alter des Mieters.
- Schriftliche Einwilligung: Eine bloß mündliche Zustimmung der Eltern ist unsicher. Bestehen Sie auf einer klaren, schriftlichen Erklärung, die den konkreten Vertrag betrifft.
- Einbindung der Eltern: Verlangen Sie entweder die Mitunterzeichnung des Mietvertrages oder eine schriftliche Bürgschaft. Nur so haben Sie eine vollwertige Haftungsgrundlage.
- Kautionsregelung: Achten Sie darauf, dass die Kaution von den Eltern oder einem Jugendhilfeträger gestellt wird. Halten Sie die Zahlungsmodalitäten im Vertrag transparent fest.
- Rechtliche Beratung: Bei langfristigen Verträgen oder komplexen Konstellationen (z. B. betreutes Wohnen, staatliche Leistungen) empfiehlt sich eine rechtliche Prüfung durch einen Anwalt oder ggf. eine familiengerichtliche Genehmigung.
Zusammenfassung
Die Vermietung an minderjährige Mieter ist rechtlich möglich, aber für Vermieter mit erheblichen Besonderheiten verbunden. Da Minderjährige nicht oder nur beschränkt geschäftsfähig sind, hängt die Wirksamkeit des Mietvertrages fast immer von der Zustimmung oder Genehmigung der Eltern ab. Ohne diese Zustimmung riskieren Vermieter, dass der Vertrag unwirksam bleibt und keine Mietzahlungen geschuldet sind.
Für die Praxis bedeutet das:
- Alters- und Identitätsprüfung des Mieters,
- schriftliche Zustimmung der Eltern oder Aufnahme als Mitmieter bzw. zumindest als Bürgen