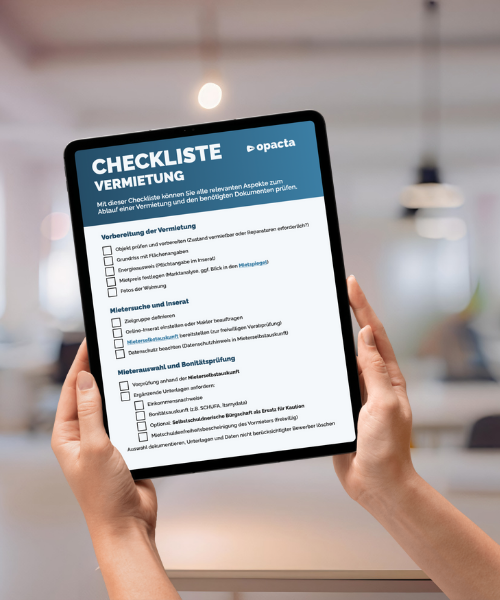Die Haltung von Haustieren in Mietwohnungen ist ein häufiger Streitpunkt zwischen Mietern, Vermietern und Nachbarn. Besonders in Mehrfamilienhäusern stellt sich regelmäßig die Frage, ob und in welchem Umfang Tiere in der Mietwohnung erlaubt sind. Viele Vermieter sind unsicher, welche Rechte sie haben. Hinzu kommt, dass das Gesetz keine ausdrücklichen Regelungen zur Tierhaltung enthält. Stattdessen hat sich durch die Rechtsprechung ein differenziertes System etabliert, das zwischen Kleintieren und größeren Haustieren unterscheidet. Dieser Beitrag gibt Ihnen als Vermieter einen systematischen Überblick über die rechtliche Lage, Ihre Möglichkeiten zur mietvertraglichen Regelung der Tierhaltung sowie den Umgang mit vertragswidriger Tierhaltung.
Kleintiere
Was ist ein Kleintier?
Nicht jedes kleine Tier ist auch im Mietrecht ein Kleintier. Im mietrechtlichen Sinne gelten Tiere als Kleintiere, wenn sie aufgrund ihrer Art, Größe und ihres Verhaltens grundsätzlich keine Gefahren oder erheblichen Belästigungen für (potenzielle) Mitbewohner darstellen und die Mietwohnung nicht über das übliche Maß hinaus abnutzen. Ein weiteres Merkmal ist, dass diese Tiere in geschlossenen Behältnissen gehalten werden können und sich nicht frei in der Wohnung oder im Gebäude bewegen.
Brauchen Mieter eine Erlaubnis für Kleintiere?
Die Haltung üblicher Kleintiere ist ohne Genehmigung erlaubt und darf mietvertraglich nicht ausgeschlossen werden, denn Haltung von Kleintieren gehört zum vertragsgemäßen Gebrauch der Mietsache durch den Mieter. Vermieter müssen daher nicht zustimmen, wenn Mieter solche Tiere halten. Die Rechtsprechung hat klargestellt, dass entsprechende pauschale Verbote im Mietvertrag unwirksam sind. Kleintiere sind z. B. Hamster oder Meerscheinchen.
Müssen die Tiere dem Vermieter gemeldet/angegeben werden?
Grundsätzlich besteht keine Pflicht zur Anzeige üblicher Kleintiere. Dennoch ist es für Vermieter empfehlenswert, in der Hausordnung bzw. im Mietvertrag festzuhalten, dass jede Tierhaltung zumindest angezeigt werden soll, um etwaige Streitigkeiten zu vermeiden. Bei eher unüblichen oder „gefährlichen“ Kleintiere sollten Mieter dies dem Vermieter je nach Einzelfall mitteilen.
Allgemein muss die Haltung der folgenden Tiere dem Vermieter angezeigt werden:
- Ratten
- Schlangen
- Vogelspinnen
- Frettchen
- Papageien
Grundsätzlich nicht angegeben werden müssen:
- Hamster
- Zwergkaninchen
- Meerschweinchen
- Ziervögel
- Zierfische
Wann besteht für Kleintiere ausnahmsweise eine Zustimmungspflicht?
Obwohl Kleintiere grundsätzlich erlaubt sind, kann in Ausnahmefällen dennoch eine Zustimmungspflicht bestehen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn ein Tier artbedingt erhebliche Geräusche oder Gerüche verursacht oder in großer Zahl gehalten wird. So kann etwa die Haltung mehrerer Frettchen in einer kleinen Wohnung oder die Anschaffung von zwanzig Hamstern zu einer unzumutbaren Belastung anderer Hausbewohner führen. Ebenso kann bei exotischen oder potenziell gefährlichen Kleintieren eine Zustimmung erforderlich sein. Für manche exotischen Tiere, insbesondere bedrohte Tierarten, ist eine (private) Haltung in Deutschland sogar ganz verboten. Auch bestimmte Hunde, wie bspw.
Staffordshire Bullterrier oder American Pit Bull Terrier, erfordern besondere Genehmigung und unterliegen strengen Auflagen. Näheres ist in den jeweiligen Hundeverordnungen der Bundesländer geregelt.
Wie viele Haustiere sind in einer Mietwohnung erlaubt?
Die Anzahl der Kleintiere muss sich im Rahmen des Üblichen bzw. vertragsgemäßen Gebrauch bewegen. In einer Einzimmerwohnung ist die Haltung einer größeren Zahl an Tieren in aller Regel unverhältnismäßig. Gerichte haben etwa entschieden, dass eine Dogge in einer kleinen Wohnung nicht artgerecht gehalten werden kann. Auch bei Kleintieren kann eine zu große Anzahl zur Störung des Hausfriedens führen. Maßgeblich ist neben der Tierart natürlich auch die Größe der Wohnung.
Größere Tiere
Wann ist die Zustimmung des Vermieters für Haustiere erforderlich?
Anders als bei Kleintieren bedarf die Haltung von Hunden, Katzen oder anderen größeren Haustieren grundsätzlich der Zustimmung des Vermieters. Diese Zustimmung kann der Vermieter jedoch nicht willkürlich verweigern. Vielmehr ist stets eine Einzelfallabwägung vorzunehmen.
Wie erfolgt die rechtliche Interessenabwägung bei größeren Tieren?
Die Entscheidung über die Tierhaltung muss auf einer nachvollziehbaren Interessenabwägung beruhen. Im Rahmen der Interessenabwägung sind sowohl die Belange des Mieters als auch des Vermieters sowie der übrigen Hausbewohner zu berücksichtigen.
Zu berücksichtigen sind insbesondere:
- Art, Größe und Verhalten des Tieres
- Größe und Lage der Mietwohnung
- Art der Wohnanlage bzw. Gegebenheiten des Mehrfamilienhauses
- Anzahl und Art weiterer Tiere im Haus
- Alter und Gesundheitszustand der Mitbewohner bzw. Nachbarn
- Besondere Bedürfnisse des Mieters (z. B. Therapiehunde oder Blindenhunde)
Haben Mieter einen Anspruch auf Zustimmung zur Tierhaltung?
Ein Anspruch des Mieters auf Erlaubnis der Tierhaltung besteht, wenn keine gewichtigen Interessen des Vermieters entgegenstehen. Dies ist etwa bei Blindenhunden oder bei Hunden, die im Rahmen einer medizinischen Behandlung erforderlich sind, der Fall.
Wann kann der Vermieter die Zustimmung zur Tierhaltung widerrufen?
Die Zustimmung zur Tierhaltung kann widerrufen werden, wenn nachträglich Umstände eintreten, die eine Haltung unzumutbar machen. Beispiele hierfür sind etwa dauerhaftes Bellen, aggressive Verhaltensweisen des Tieres oder Belästigungen anderer Bewohner bzw. Nachbarn.
Sind Hunde und Katzen in der Mietwohnung erlaubt oder verboten?
Hunde und Katzen gehören mietrechtlich nicht zu den Kleintieren. Zwar sind sie in vielen Haushalten verbreitet, jedoch besteht aufgrund ihrer potenziellen Auswirkungen auf den Hausfrieden und der Gefahr von Schäden an der Wohnung eine grundsätzliche Erlaubnispflicht. Einzelne Gerichte haben in Ausnahmefällen sehr kleine Hunde als Kleintiere angesehen, dies ist jedoch nicht ständige Rechtsprechung. Daher sollten Vermieter auf der Einholung einer ausdrücklichen Genehmigung bestehen.
Ausschluss der Tierhaltung im Mietvertrag
Darf Tierhaltung im Mietvertrag generell verboten werden?
Ein generelles Verbot jeglicher Tierhaltung in Formularmietverträgen (= Allgemeine Geschäftsbedingungen, AGB) ist unwirksam. Es stellt eine unangemessene Benachteiligung des Mieters dar und wird von der Rechtsprechung seit Jahren einheitlich abgelehnt. Dies gilt auch für Hunde und Katzen, da auch hier stets eine Einzelfallprüfung erfolgen muss.
Ist ein Erlaubnisvorbehalt im Mietvertrag rechtlich zulässig?
Auch eine Klausel, die die Tierhaltung unter einen allgemeinen Erlaubnisvorbehalt stellt, ist nur wirksam, wenn sie klar zwischen erlaubnisfreien Kleintieren und zustimmungspflichtigen größeren Tieren differenziert. Auch muss geregelt sein, dass die Zustimmung nur aus sachlichen Gründen verweigert werden darf. Klauseln, die dem Vermieter ein „freies Ermessen“ einräumen, sind ebenso unwirksam wie Regelungen, die nur einzelne Tierarten wie Ziervögel oder Zierfische zulassen, andere übliche Kleintiere jedoch ausschließen. Eine wirksame und vermieterfreundliche Tierhaltungsklausel finden Sie in unseren Mietvertragsvorlagen.
Welche Folgen hat eine vertragswidrige Tierhaltung?
Unterlassungsanspruch des Vermieters
Hält ein Mieter ein Tier ohne erforderliche Erlaubnis oder trotz ausdrücklichen Verbots, so kann der Vermieter verlangen, dass der Mieter dies unterlässt. Gleiches gilt, wenn ein Tier zwar genehmigt wurde, aber erhebliche Störungen vorliegen und der Vermieter die Zustimmung berechtigterweise widerrufen hat.
Kündigungsrecht des Vermieters
Bei anhaltender oder besonders schwerwiegender Pflichtverletzung kann auch eine Kündigung des Mietverhältnisses in Betracht kommen. Eine ordentliche Kündigung ist aber nur nach vorheriger Abmahnung möglich. Eine fristlose Kündigung ist nur dann möglich, wenn eine erhebliche Beeinträchtigung besteht und ist in der Praxis selten ohne Abmahnung durchsetzbar. Bei langjähriger Duldung oder fehlender Abmahnung, obwohl der Vermieter von den Beeinträchtigungen und Problemen durch die Tiere weiß, kann es sein, dass er sein Kündigungsrecht verliert („Verwirkung“). Sie sollten daher, wenn die Haustiere Ihrer Mieter erhebliche Schäden und Belästigungen verursachen, sofort handeln. In unseren Vermieterpaketen Plus und Premium haben sie Zugriff auf eine Vorlage für die Abmahnung Ihrer Mieter.
Wann haften Mieter für Schäden durch Haustiere?
Nicht jeder Kratzer ist ein Schaden. Es muss zwischen einer gewöhnlichen Abnutzung und einer ersatzpflichtigen Beschädigung durch das Tier unterschieden werden.
Was zählt als vertragsgemäßer Gebrauch bei Tierschäden?
Grundsätzlich gilt, dass Mietern für Schäden, die durch ihre Haustiere verursacht wurden, nicht automatisch haften. Solange es sich um Abnutzungen oder Spuren handelt, die im Rahmen des gewöhnlichen Wohngebrauchs entstehen, haften Mieter nach § 538 BGB nicht. Kratzspuren im Parkett, die durch die normale Fortbewegung eines Hundes entstehen gelten regelmäßig als vertragsgemäße Abnutzung. Auch kleinere Gebrauchsspuren an Wänden oder Türen sind hinzunehmen, sofern sie nicht auf ein Verhalten zurückzuführen sind, das über die artgerechte Tierhaltung hinausgeht.
Wann liegt eine ersatzpflichtige Beschädigung durch Tiere vor?
Eine Haftung des Mieters kommt dann in Betracht, wenn die Beeinträchtigungen durch das Tier über das normale Maß hinausgehen oder vermeidbar gewesen wären. Dies betrifft zum Beispiel auffällige Kratz- oder Bissspuren an Türen oder Böden, die auf Scharren, Springen oder abruptes Stoppen zurückzuführen sind. Auch Schäden durch Tierkot oder Urin, etwa durch wiederholtes Markieren in der Wohnung, gelten als vertragswidrige Nutzung. Hier droht dem Mieter regelmäßig eine Ersatzpflicht. Besonders sensibel ist die Rechtslage bei hochwertigen Bodenbelägen. Ist ein besonders teurer Boden verlegt, wird von Mietern eine gesteigerte Sorgfalt erwartet.
Welche Bedeutung haben Tierhaltungsklauseln für die Haftung des Mieters?
Ist die Tierhaltung ausdrücklich erlaubt, bedeutet dies nicht, dass der Mieter für alle Folgen der Tierhaltung freigestellt ist. Die Erlaubnis schützt nur vor einer Kündigung, nicht aber vor Haftung bei unsachgemäßer Haltung oder anderer konkreter Pflichtverletzungen. Umgekehrt gilt: Ist das Verhalten des Tieres artgerecht und die Haltung sachgemäß, entfällt in der Regel die Schadensersatzpflicht. Individuelle Tierhaltungsklauseln im Mietvertrag können die Haftung näher regeln. Die Wirksamkeit solcher Klauseln hängt jedoch, wenn es sich um AGB in Form von Mietvertragsvorlagen handelt, nach § 307 BGB davon ab, ob sie den Mieter unangemessen benachteiligen oder nicht.
Dürfen Besucher Hunde oder Katzen mit in die Mietwohnung bringen?
Empfängt ein Mieter Besucher mit Hund oder übernimmt er vorübergehend die Betreuung eines Hundes oder einer Katze, so begründet dies noch keine eigene Tierhaltung im mietrechtlichen Sinne. Eine solche gelegentliche oder vorübergehende Aufnahme erfordert grundsätzlich keine Zustimmung des Vermieters. Entscheidend ist, dass es sich nicht um eine dauerhafte oder regelmäßige Tierhaltung handelt.
Anders kann die rechtliche Bewertung jedoch ausfallen, wenn im Mietvertrag wirksam ein Verbot der Hundehaltung vereinbart wurde. In diesem Fall kann bereits die wiederholte Aufnahme eines Tieres – auch zur Betreuung – als Verstoß gegen die vertragliche Regelung gewertet werden.
Zusammenfassung
Für Vermieter gilt: Die Haltung üblicher Kleintiere müssen Sie grundsätzlich hinnehmen. Bei größeren Tieren wie Hunden oder Katzen kommt es auf den Einzelfall an. Ein generelles Verbot ist nicht zulässig, wohl aber ein sachlich begründeter Erlaubnisvorbehalt. Wichtig ist eine differenzierte und rechtssichere Vertragsgestaltung (opacta Mietrechtsvorlagen). Kommt es zu Störungen oder unerlaubter Tierhaltung, stehen Ihnen Unterlassungsansprüche und in Extremfällen auch ein Kündigungsrecht zur Verfügung. Lassen Sie sich im Zweifel rechtlich beraten, um Ihre Interessen als Vermieter wirksam durchzusetzen.