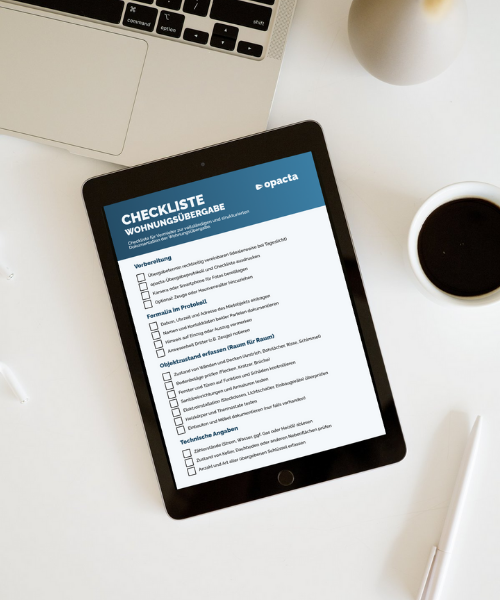Die Unterschrift ist entscheidend für die Wirksamkeit eines schriftlichen Mietvertrags. Doch wer muss tatsächlich unterzeichnen und wie? Ob Ehepartner, Wohngemeinschaft oder Vertretung durch Dritte, schon kleine Fehler können rechtliche Folgen haben. Dieser Beitrag zeigt, welche Regeln gelten und wie Vermieter typische Risiken vermeiden.
Grundprinzipien beim Abschluss eines Mietvertrags
Angebot und Annahme
Ein Mietvertrag kommt durch Angebot und Annahme zustande. Stehen auf einer Seite mehrere Personen, müssen grundsätzlich alle als Vertragspartei genannten Personen unterschreiben. Unterzeichnet nicht jeder vorgesehene Mieter, hängt die Wirksamkeit vom Vorliegen einer wirksamen Vertretung ab; fehlt diese, ist der Vertrag mit den übrigen Unterzeichnern zu schließen oder anzupassen. Ein Mietvertrag kann aber grundsätzlich auch nur mündlich abgeschlossen werden.
Wann ist die Schriftform erforderlich und wann nicht?
Ein Mietvertrag muss nicht zwingend schriftlich sein, er kann auch mündlich oder konkludent (= ohne ausdrückliche Willenserklärung bspw. durch faktischen Einzug und Mietzahlung) geschlossen werden.
Bestimmte Abreden entfalten jedoch nur bei Schriftform Wirkung, insbesondere eine Befristung von mehr als einem Jahr sowie ein längerfristiger Kündigungsverzicht (vgl. § 550 BGB). In der Praxis dient der schriftliche Vertrag zudem der besseren Beweisbarkeit von Abrechen.
Erforderliche Unterschriften
Ist Schriftform vereinbart oder gesetzlich erforderlich, gilt § 126 BGB:
a) Entweder beide Parteien unterschreiben dieselbe Urkunde, oder
b) es werden mehrere gleichlautende Exemplare erstellt und jede Partei unterzeichnet das für die jeweils andere Partei bestimmte Exemplar.
Für den Zugang der Erklärung ist maßgeblich, dass jede Partei, also Vermieter und Mieter, ein von der anderen Partei unterschriebenes Exemplar erhält (§ 130 Abs. 1 S. 1 BGB).
Es ist nicht zwingend erforderlich, dass eine einzige Urkunde von Vermieter und Mieter unterzeichnet wird. In der Praxis unterschreiben oft beide Parteien beide Exemplare und jeder behält einen Original-Mietvertrag.
Form der Unterschrift und Platzierung
Die Unterschrift muss eigenhändig geleistet werden, am Ende des Vertrages (Abschlussfunktion der Unterschrift). Unterschriften neben oder über dem Vertragstext genügen nicht. Änderungen im Vertragstext sind innerhalb des Textes vorzunehmen; umfangreiche Änderungen sollten als Anlage dokumentiert und von allen Parteien erneut unterschrieben werden.
Werden in den beiden Vertragsexemplaren unterschiedliche Inhalte verwendet, gilt eine abweichende Regelung regelmäßig als nicht vereinbart (Beispiel: nur im Vermieter‑Exemplar eingetragener Kündigungsverzicht wurde nicht wirksam).
Elektronische Form
Die Schriftform kann durch elektronische Form ersetzt werden, wenn das Gesetz nichts anderes bestimmt (§ 126 Abs. 3 BGB). Dafür ist eine qualifizierte elektronische Signatur erforderlich. Eingescannte oder „eingefügte“ Unterschriften per PDF/E‑Mail genügen nicht. Beide Parteien müssen ein kompatibles Signatursystem nutzen.
Wer muss unterschreiben?
Einzelmieter
Steht auf Mieterseite nur eine Person, muss ausschließlich diese den Vertrag eigenhändig unterzeichnen. Sie ist dann alleinige Vertragspartnerin und für sämtliche Verpflichtungen – insbesondere die Mietzahlung – verantwortlich.
Ehepartner und eingetragene Lebenspartner
Treten beide als Mieter auf, müssen grundsätzlich beide unterschreiben. Unterzeichnet nur einer, wird der andere nur dann Vertragspartei, wenn eine wirksame Vertretung vorliegt. Diese muss erkennbar sein, etwa durch den Zusatz „i. V.“ und eine entsprechende Vollmacht, welche idealerweise als Anlage dem Mietvertrag beigefügt wird.
Allein die Ehe oder eingetragene Lebenspartnerschaft begründet keine automatische Vertretungsbefugnis. Zieht ein Ehepartner erst später ein, ohne im Vertrag genannt zu sein, wird er nicht automatisch Mieter.
Lebensgemeinschaften ohne Trauschein
Leben zwei Partner zusammen, ohne verheiratet zu sein, kann keiner den anderen ohne ausdrückliche Vollmacht vertreten. Fehlt die Unterschrift eines im Vertrag genannten Partners, muss der Vertrag angepasst werden oder ein Untermietverhältnis mit Zustimmung des Vermieters vereinbart werden. Natürlich ist es aber auch möglich, dass nur einer Vertragspartner, sprich Mieter wird und der Vermieter dem anderen erlaubt, mit in der Wohnung zu wohnen. Für Vermieter ist es meist besser zwei Mieter zu haben, da so zwei Personen für die Mietzahlung einstehen.
Wohngemeinschaften (WGs)
Bei einer WG können alle Bewohner als Hauptmieter unterzeichnen. Vorteil dieses WG-Modells ist, dass der Vermieter Ansprüche gegen alle richten kann. Allerdings erfordern Vertragsänderungen die Zustimmung aller Mieter und Mieterhöhungen oder Kündigungen müssen an sämtliche Mieter zugestellt werden.
Alternativ kann nur eine Person Hauptmieter werden und mit den übrigen Bewohnern Untermietverträge schließen.
Weitere Informationen: WG-Vermietungsmodelle.
Minderjährige Mieter
Minderjährige benötigen stets die Zustimmung ihrer Erziehungsberechtigten. Diese muss schriftlich vorliegen, andernfalls ist der Vertrag schwebend unwirksam. Auch ein Untermietvertrag mit einem Minderjährigen bedarf dieser Zustimmung. Weitere Informationen: Vermieten an Minderjährige.
Unterschriften mit Vertretung
Voraussetzungen für eine wirksame Vertretung bei Mietverträgen
Unterschreibt eine Person für eine andere Vertragspartei, muss eine entsprechende Vertretungsbefugnis vorliegen. Diese kann sich aus einer schriftlichen Vollmacht, aus gesetzlicher Vertretung (z. B. beide Eltern für Minderjährige, § 1926 Abs. 1 S. 2 BGB) oder aus einer organschaftlichen Stellung (z. B. Geschäftsführer einer GmbH, § 35 Abs. 1 GmbHG) ergeben. Ohne Vertretungsbefugnis ist die Unterschrift für den Vertretenen nicht bindend.
Form und Inhalt der Vollmacht
Eine Vollmacht sollte in Schriftform vorliegen und den Vertreter klar benennen. Sie muss von allen Vollmachtgebern unterzeichnet sein, wenn mehrere Personen vertreten werden. Der Umfang der Vollmacht – etwa Abschluss und Änderung des Mietvertrags – sollte ausdrücklich angegeben werden.
Vertretungshinweise im Mietvertrag
Der Vertretungswille muss aus der Unterschrift erkennbar sein. Der Zusatz „i. V.“ („in Vertretung“) zeigt an, dass die unterzeichnende Person eine eigene Willenserklärung für den Vertretenen abgibt.
Der Zusatz „i. A.“ („im Auftrag“) deutet hingegen auf eine Botentätigkeit hin und ist rechtlich riskant, weil er nicht zwingend auf eine Vertretungserklärung hinweist.
Besondere Konstellationen
- Hausverwaltung: Handelt eine Hausverwaltung für den Vermieter, sollte die Vertretung im Mietvertrag oder einer separaten Urkunde ausdrücklich genannt werden.
- Erbengemeinschaften: Besteht die Vermieterseite aus mehreren Personen, müssen entweder alle unterzeichnen oder eine Person wird mit schriftlicher Vollmacht ausgestattet, die alle Vollmachtgeber unterschrieben haben.
- Ehepartner oder Lebenspartner: Hier besteht – ohne Vollmacht – keine automatische Vertretungsbefugnis.
Praktische Abläufe der Unterzeichnung
Unterzeichnung bei gleichzeitiger Anwesenheit
Am einfachsten ist es, wenn Mieter und Vermieter gemeinsam anwesend sind und beide Vertragsexemplare gleichzeitig unterschreiben. So können offene Fragen direkt geklärt und Ergänzungen einvernehmlich vorgenommen werden. Jede Partei erhält anschließend ein Original mit beiden Unterschriften.
Unterzeichnung getrennt (per Post)
Kommt die Unterzeichnung nicht gleichzeitig zustande, werden die Vertragsexemplare in der Regel per Post versendet.
Dabei gilt § 126 Abs. 2 BGB: Werden mehrere gleichlautende Exemplare erstellt, genügt es, wenn jede Partei die für die andere Partei bestimmte Urkunde unterzeichnet.
Es gibt zwei gängige Vorgehensweisen:
- Variante 1 (Vermieter unterschreibt zuletzt): Der Vermieter sendet dem Mieter zwei von ihm ausgefüllte, aber noch nicht unterschriebene Exemplare. Der Mieter unterschreibt beide und sendet sie zurück. Der Vermieter unterzeichnet eines davon und gibt es dem Mieter zurück. Vorteil für den Vermieter: Er kann prüfen, ob der Mieter Änderungen vorgenommen hat, bevor er selbst unterschreibt.
- Variante 2 (Mieter unterschreibt zuletzt): Der Vermieter unterzeichnet beide Exemplare und sendet sie dem Mieter. Dieser behält eines, unterschreibt das andere und sendet es zurück. Vorteil für den Mieter: geringeres Risiko unbemerkter Änderungen durch den Vermieter.
In beiden Varianten muss jede Partei ein von der anderen Partei unterschriebenes Exemplar erhalten.
Achtung: Bei Abschluss eines Mietvertrags über den Postweg ohne vorherige Besichtigung der Wohnung kann ein Widerrufsrecht des Mieters bestehen. Wird dieser hierüber nicht ordnungsgemäß belehrt, verlängert sich die Widerrufsfrist von 2 Wochen auf 1 Jahr und 2 Wochen. Weitere Informationen finden Sie hier: Widerrufsrecht beim Mietvertrag.
Originale und Kopien
Jede Partei sollte ein Original aufbewahren. Zusätzlich empfiehlt sich eine Kopie zur internen Ablage. Bei elektronischer Archivierung ist sicherzustellen, dass die unterschriebene Fassung vollständig eingescannt wird.
Änderungen und Ergänzungen im Mietvertrag
Änderungen sollten direkt im Vertragstext vorgenommen und von allen Vertragsparteien an der betreffenden Stelle mitunterzeichnet werden; umfangreiche Anpassungen werden idealerweise in einer gesonderten, als Anlage bezeichneten Vereinbarung festgehalten, die ebenfalls von allen Parteien unterschrieben ist.
Wichtig ist, dass beide Vertragsexemplare identisch sind. Weichen Inhalte ab, gilt eine Regelung in der Regel als nicht vereinbart, wie etwa bei einem nur im Exemplar des Vermieters enthaltenen Kündigungsverzicht.
Häufige Fehler beim Mietvertragsabschluss
- Fehlende Unterschrift einer Vertragspartei: Ohne wirksame Vertretung wird diese Person nicht Vertragspartner; Ansprüche gegen sie sind ausgeschlossen.
- Unterschrift an falscher Stelle: Unterschriften neben oder über dem Vertragstext erfüllen nicht die gesetzlichen Anforderungen (Abschlussfunktion der Unterschrift).
- Abweichende Inhalte in den Vertragsexemplaren: Unterschiedliche Regelungen gelten in der Regel als nicht vereinbart (z. B. Kündigungsverzicht nur im Vermieter-Exemplar).
Zusammenfassung
Für die Wirksamkeit eines Mietvertrags ist entscheidend, dass alle als Vertragspartei genannten Personen den Vertrag eigenhändig unterschreiben oder wirksam vertreten werden.
Die Schriftform nach § 126 BGB kann durch gleichlautende Vertragsexemplare gewahrt werden, wenn jede Partei die für die andere bestimmte Urkunde unterzeichnet.
Änderungen müssen in allen Exemplaren identisch sein und von allen Parteien bestätigt werden. Häufige Fehler wie fehlende Unterschriften, falsche Platzierung oder abweichende Inhalte lassen sich durch sorgfältige Prüfung vor Vertragsabschluss vermeiden.
Wer diese Grundsätze beachtet, minimiert rechtliche Risiken und schafft eine klare Grundlage für das Mietverhältnis.