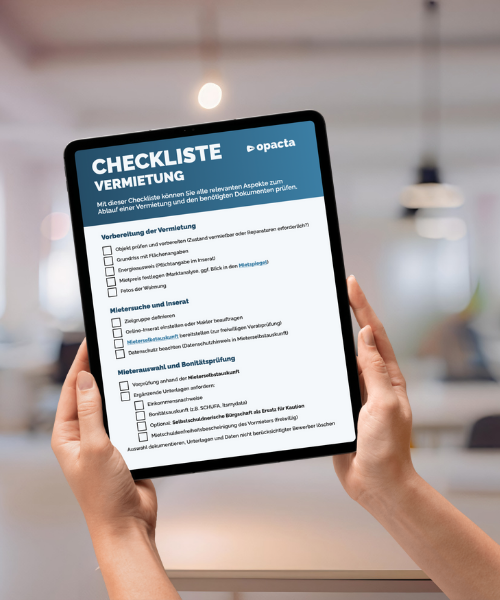Eine geerbte Immobilie kann Chance und Belastung zugleich sein. Während der emotionale Wert oft im Vordergrund steht, treten für Erben schnell rechtliche und finanzielle Fragen auf. Soll das Erbe angenommen oder ausgeschlagen werden? Welche Kosten kommen auf mich als neuer Eigentümer zu? Und welche Möglichkeiten gibt es – Verkauf, Vermietung oder Selbstnutzung?
Dieser Beitrag zeigt Ihnen, welche Schritte bei einer Immobilienerbschaft wichtig sind und worauf Sie als (neuer) Vermieter besonders achten sollten.
Schritt 1: Überblick verschaffen – Annahme oder Ausschlagung des Erbes
Mit dem Tod des Erblassers geht der gesamte Nachlass automatisch auf die Erben über (§ 1922 BGB). Das bedeutet, dass Sie nicht nur Vermögen wie Immobilien oder Bankguthaben übernehmen, sondern auch sämtliche Verbindlichkeiten, etwa offene Darlehen. Eine sogenannte „Rosinenpickerei“ ist nicht möglich, der Nachlass kann nur insgesamt angenommen oder vollständig ausgeschlagen werden.
Gerade wenn Schulden die Werte übersteigen, ist es sinnvoll, das Erbe auszuschlagen. Die Frist hierfür ist eng bemessen. In der Regel beträgt sie sechs Wochen ab Kenntnis des Erbfalls oder ab Eröffnung eines Testaments. Hatte der Verstorbene seinen letzten Wohnsitz im Ausland, verlängert sich die Frist auf sechs Monate. Lassen Sie diese Frist verstreichen, gilt die Erbschaft als angenommen, eine nachträgliche Ausschlagung ist dann kaum noch möglich.
Für (werdende) Vermieter bedeutet das: Zunächst muss geklärt werden, ob die geerbte Immobilie langfristig eine Chance darstellt oder ob sie durch eine zu hohe Beleihung oder aufwendige Sanierungsarbeiten zur finanziellen Belastung wird. Ein schneller Überblick über Vermögen und Verbindlichkeiten des Nachlasses ist deshalb der erste und wichtigste Schritt.
Schritt 2: Wert der Immobilie ermitteln
Bevor Sie Entscheidungen treffen, sollten Sie den tatsächlichen Wert der geerbten Immobilie kennen. Dazu gehört nicht nur der reine Marktwert, sondern auch eine genaue Übersicht über Belastungen wie Grundschulden.
Einen ersten Anhaltspunkt gibt ein Grundbuchauszug, den Sie beim zuständigen Grundbuchamt beantragen können. Banken des Erblassers geben zusätzlich Auskunft über offene Kredite, Kontoguthaben oder laufende Mieteinnahmen – vorausgesetzt, Sie können Ihre Erbenstellung durch Erbschein oder (notarielles) Testament nachweisen.
Am wichtigsten ist natürlich die bereits vereinbarte Miethöhe oder die Miete, die marktüblich verlangt werden kann (weitere Informationen zur Berechnung: ortsübliche Vergleichsmiete ermitteln).
Ebenso entscheidend ist der bauliche Zustand des Objekts. Ist das Dach intakt, die Heizung funktionstüchtig oder besteht Sanierungsbedarf? Ein Gutachter oder Bausachverständiger kann hier Klarheit schaffen und den Verkehrswert realistisch einschätzen.
Diese Bewertung ist nicht nur Grundlage für die Entscheidung über Annahme oder Ausschlagung des Erbes, sondern auch wichtig für steuerliche Fragen und eine mögliche Vermietung oder Veräußerung.
Schritt 3: Eigentumsumschreibung im Grundbuch
Nehmen Sie das Erbe an, müssen Sie sich als neuer Eigentümer im Grundbuch eintragen lassen. Dafür ist in der Regel ein Erbschein erforderlich, der Ihre Erbenstellung nachweist und beim Nachlassgericht beantragt werden kann. Liegt ein notarielles Testament vor, genügt auch dieses. Ein einfach handschriftliches Testament reicht hingegen nicht.
Die Grundbuchumschreibung ist für Erben gebührenfrei, wenn sie innerhalb von zwei Jahren nach dem Erbfall beantragt wird. Besonders in Erbengemeinschaften empfiehlt sich ein gemeinschaftlicher Erbschein oder ein Teilerbschein, in dem die jeweiligen Erbquoten festgehalten sind.
Erst durch die Eintragung im Grundbuch werden Sie offiziell als neuer Eigentümer anerkannt und können anschließend über Verkauf, Vermietung oder Selbstnutzung entscheiden. Leider kann dies erfahrungsgemäß bis zu einem Jahr dauern, daher wird in der Praxis meist mit einer Vormerkung gearbeitet.
Schritt 4: Optionen für die geerbte Immobilie
Sobald Sie als Eigentümer eingetragen sind, stellt sich die Frage: Was tun mit der Immobilie?
Grundsätzlich haben Sie drei Möglichkeiten – verkaufen, vermieten oder selbst nutzen. Jede Option bringt Chancen, aber auch Pflichten und Risiken mit sich.
- Verkaufen:
Ein Verkauf schafft sofortige Liquidität. Das ist oft sinnvoll, wenn Sie selbst keine Verwendung für die Immobilie haben oder wenn in einer Erbengemeinschaft alle Erben ausgezahlt werden müssen.
Zu beachten ist allerdings die Spekulationsfrist: Liegt zwischen Anschaffung durch den Erblasser und Verkauf weniger als zehn Jahre, ist der Verkauf nicht steuerfrei („Spekulationssteuer“). Weitere Informationen: Ablauf Immobilienkauf und -verkauf.
- Vermieten:
Eine Vermietung sorgt für laufende Einnahmen und kann langfristig Vermögensaufbau bedeuten. Hinzu kommt ein steuerlicher Vorteil: Vermietete Wohnimmobilien werden für die Erbschaftsteuer nur zu 90 % ihres Wertes angesetzt (§ 13d ErbStG).
Vermieter sollten aber bedenken, dass Verwaltung, Instandhaltung und mögliche Mietausfälle zusätzliche Verantwortung mit sich bringen. Bedenken Sie, dass die Mietverwaltung mit den Mietrechtsvorlagen von opacta deutlich stressfreier ist, als mit kostenlosen Vorlagen, die Sie sich erst zusammensuchen müssen.
- Selbst nutzen:
Für Ehepartner und Kinder gibt es eine besondere Steuerbefreiung: Wird die geerbte Immobilie mindestens zehn Jahre lang selbst bewohnt, bleibt sie unabhängig vom Freibetrag steuerfrei.
Bei Kindern gilt diese Vergünstigung bis zu einer Wohnfläche von 200 m². Bei Immobilien, die sich schon lange in Familieneignetum befinden kann die Eigennutzung zumindest aus emotionaler Sicht sinnvoll sein.
- Leerstand:
Ein vorübergehender Leerstand kann manchmal unumgänglich sein, etwa bei Sanierungen oder ungeklärter Erbengemeinschaft. Langfristig ist er jedoch die schlechteste Option, da Kosten anfallen, ohne dass Erträge erzielt werden. Zudem sinkt der Wert leerstehender Immobilien oft schneller.
Rechte und Pflichten aus bestehenden Mietverhältnissen
Viele Erben übernehmen nicht nur die Immobilie selbst, sondern auch bestehende Mietverträge. Der Grundsatz lautet: „Kauf bricht nicht Miete“ – und Erbe ebenso wenig. Nach § 566 BGB treten Erben automatisch in die Vermieterstellung ein.
Das bedeutet:
- Mietverträge laufen zu den bisherigen Bedingungen weiter.
- Ein Sonderkündigungsrecht des Erben allein wegen des Todes des Vermieters besteht nicht.
- Eigenbedarfskündigungen sind nur unter den gesetzlichen Voraussetzungen möglich (vgl. § 573 BGB).
- Erben müssen die ordnungsgemäße Instandhaltung der Mietwohnung und Betriebskostenabrechnung sicherstellen.
Für Mieter schafft dies Sicherheit, für Erben bedeutet es zusätzliche Verantwortung. Wer eine vermietete Immobilie erbt, sollte daher prüfen, ob Verwaltung und Instandhaltung selbst übernommen werden können (z.B. mit den Vermietervorlagen von opacta) oder ob eine Hausverwaltung beauftragt wird.
Kosten der Erbschaft von Immobilien im Überblick
Mit einer Immobilienerbschaft gehen auch Kosten und steuerliche Belastungen einher. Diese sollten Sie von Beginn an einkalkulieren, um finanzielle Überraschungen zu vermeiden.
- Erbschaftsteuer: Je nach Verwandtschaftsgrad gelten Freibeträge – 500.000 € für Ehepartner, 400.000 € für Kinder, 200.000 € für Enkel. Nur der übersteigende Wert muss versteuert werden. Vermietete Immobilien werden steuerlich begünstigt, da ihr Wert um 10 % reduziert angesetzt wird (§ 13d ErbStG).
- Notar- und Grundbuchkosten: Für Erbschein, Grundbucheintrag oder Teilungserklärungen können zwischen 1 % und 2,5 % des Immobilienwerts anfallen.
- Gutachterkosten: Für eine Verkehrswertermittlung sollten Sie je nach Umfang zwischen 500 € und 1,5 % des Immobilienwerts einplanen.
- Laufende Kosten: Auch nach der Erbschaft fallen Grundsteuer, Versicherungen, Betriebskosten und Instandhaltungen an – in der Regel 1–2 % des Immobilienwerts pro Jahr.
- Besonderheit Grunderwerbsteuer: Diese fällt bei Erbschaften grundsätzlich nicht an.
Ein vollständiger Kostenüberblick ist entscheidend, um zu entscheiden, ob die Immobilie behalten oder verkauft werden sollte.
Erbengemeinschaft und Konflikte
Häufig wird eine Immobilie nicht an eine Einzelperson, sondern an mehrere Erben vererbt. Dann entsteht automatisch eine Erbengemeinschaft. In dieser Konstellation können Entscheidungen, etwa über Verkauf, Vermietung oder Nutzung, nur gemeinsam getroffen werden.
Problematisch wird es, wenn keine Einigung erzielt wird. Typische Konflikte betreffen die Höhe von Ausgleichszahlungen, den Zeitpunkt eines Verkaufs oder die Nutzung durch einzelne Miterben. Kommt es zu keiner Lösung, droht im schlimmsten Fall eine Teilungsversteigerung, bei der das Objekt sogar unter Wert verkauft werden kann.
Um dies zu vermeiden, bietet sich eine Mediation oder Streitschlichtung an. Ein neutraler Dritter kann helfen, Interessen auszugleichen und eine gemeinsame Lösung zu finden. Denkbar ist auch, dass ein Erbe die Immobilie übernimmt und die anderen auszahlt. Wer frühzeitig klare Absprachen trifft und seine Nachfolge korrekt gestaltet, kann langwierige und emotional aufgeladene Rechtsstreitigkeiten und unnötige Kosten vermeiden.
Fazit
Eine geerbte Immobilie bedeutet Chancen und Pflichten bzw. Risiken zugleich. Entscheidend ist ein schnelles, strukturiertes Vorgehen: Wert und Belastungen prüfen, Grundbuchumschreibung vornehmen und über Verkauf, Vermietung oder Selbstnutzung entscheiden.
Achten Sie dabei auf Kosten, Steuern und bestehende Mietverhältnisse. Wer frühzeitig Klarheit schafft, vermeidet Konflikte und kann das Erbe sinnvoll nutzen.