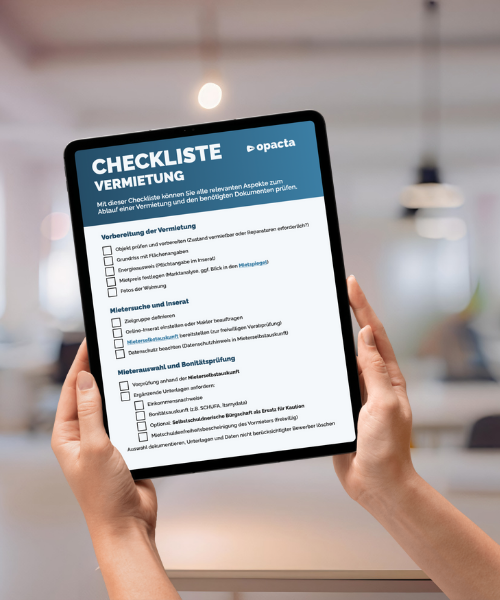Ob Lärm im Treppenhaus, das Abstellen von Fahrrädern oder die Nutzung des Gartens, das alltägliche Zusammenleben in einem Mehrfamilienhaus birgt Konfliktpotenzial. Eine klar formulierte Hausordnung hilft Vermietern, für Ordnung, Sicherheit und ein respektvolles Miteinander im Haus zu sorgen.
Doch was darf darin geregelt werden, wann ist sie verbindlich und wo sind die rechtlichen Grenzen? Dieser Beitrag gibt einen Überblick über zulässige Inhalte, rechtliche Voraussetzungen und typische Fehlerquellen bei der Gestaltung einer Hausordnung.
Bedeutung und Funktion der Hausordnung
Die Hausordnung ist ein bewährtes Instrument, um das Zusammenleben in einem Mehrfamilienhaus zu regeln und Konflikte zwischen Mietparteien vorzubeugen. Sie enthält Regelungen für die Nutzung von Gemeinschaftseinrichtungen, Verhaltensvorgaben und organisatorische Hinweise.
Auch wenn es keine gesetzliche Pflicht zur Aufstellung einer Hausordnung gibt, ist sie in der Praxis für nahezu jede vermietete Immobilie üblich.
Für Vermieter erfüllt die Hausordnung dabei zwei zentrale Funktionen:
- Ordnung und Klarheit: Sie konkretisiert allgemeine mietvertragliche Pflichten (z. B. Rücksichtnahme, pfleglicher Gebrauch der Mietsache) und schafft eine einheitliche Grundlage für das Verhalten im Haus.
- Prävention und Durchsetzung: Durch klare Regeln lassen sich Konflikte vermeiden und Verstöße, sofern die Hausordnung Bestandteil des Mietvertrags ist, rechtlich sanktionieren.
Im Zusammenspiel mit dem Mietvertrag stärkt eine wirksam gestaltete Hausordnung die Position des Vermieters und trägt zur langfristigen Erhaltung des Hausfriedens bei.
Allgemeine vs. vertragsgebundene Hausordnung
Ein wesentlicher Unterschied besteht zwischen der allgemeinen Hausordnung (z. B. als Aushang im Treppenhaus) und einer vertragsgebundenen Hausordnung, die ausdrücklich Bestandteil des Mietvertrags ist.
Allgemeine Hausordnung
Eine allgemeine Hausordnung wird häufig im Hausflur ausgehängt oder nachträglich verteilt. Sie hat rein ordnenden Charakter und dient lediglich der Konkretisierung bereits bestehender gesetzlicher oder vertraglicher Pflichten. Derartige Regelungen betreffen typischerweise:
- Ruhezeiten
- Öffnungs- und Schließzeiten der Haustür
- Nutzung von Gemeinschaftseinrichtungen (Waschküche, Garten etc.)
- Sicherheits- und Brandschutzhinweise
Wichtig: Eine allgemeine Hausordnung darf keine zusätzlichen Pflichten begründen. Sie kann also keine Reinigungspflichten oder Räumdienste anordnen, sofern diese nicht bereits im Mietvertrag geregelt sind.
Vertragsgebundene Hausordnung
Wird die Hausordnung hingegen als Anlage zum Mietvertrag vereinbart oder im Vertrag ausdrücklich auf die Hausordnung verwiesen, ist sie für den Mieter verbindlich.
Damit können über die allgemeinen Verhaltenserwartungen hinaus konkrete Verpflichtungen auferlegt werden, z. B.:
- Reinigung des Treppenhauses im wöchentlichen Turnus
- Winterdienst auf dem Gehweg
- eingeschränkte Nutzung von Balkon und Garten
- Pflichten zur Lüftung und Heizverhalten
- Gestaltungsregelungen für das Klingelschild
Diese vertragliche Bindung ermöglicht es dem Vermieter, bei Verstößen Abmahnungen auszusprechen und sofern der Mieter die Hausordnung wiederholt missachtet, gegebenenfalls auch außerordentlich zu kündigen (§ 543 BGB).
Weiterführend: Außerordentliche Kündigung – Wann dürfen Vermieter fristlos kündigen?
Was sind die Voraussetzungen einer wirksamen Hausordnung?
Für die Aufstellung einer Hausordnung besteht im deutschen Mietrecht grundsätzlich keine gesetzliche Pflicht. Das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) sieht keine ausdrückliche Regelung zur Hausordnung vor. Ihre rechtliche Zulässigkeit ergibt sich vielmehr aus der allgemeinen Vertragsfreiheit und dem Bedürfnis nach Konkretisierung mietvertraglicher Pflichten.
Eine gesetzliche Sonderregelung gilt hingegen für Wohnungseigentümergemeinschaften (WEG):
Gemäß § 19 Abs. 2 Nr. 1 WEG zählt die Aufstellung einer Hausordnung zu den Maßnahmen ordnungsgemäßer Verwaltung. Die durch Beschluss gefasste WEG-Hausordnung gilt unmittelbar für alle Wohnungseigentümer, jedoch nicht automatisch für deren Mieter. Um auch Mieter an diese Regeln zu binden, muss die WEG-Hausordnung ausdrücklich in den Mietvertrag aufgenommen werden.
Für die Wirksamkeit einer Hausordnung im Mietverhältnis gilt:
- Eine allgemeine Hausordnung, die lediglich im Treppenhaus aushängt, entfaltet keine eigenständige Bindungswirkung über den Mietvertrag hinaus. Sie kann das Verhalten der Mieter zwar beeinflussen, aber keine zusätzlichen Pflichten begründen.
- Eine vertragsgebundene Hausordnung wird nur dann verbindlich, wenn sie dem Mieter bei Vertragsschluss übergeben, dem Mietvertrag als Anlage beigefügt oder ausdrücklich im Mietvertrag in Bezug genommen wird.
- Nachträgliche Änderungen sind bei einer mietvertraglich vereinbarten Hausordnung nur mit Zustimmung des Mieters zulässig (§ 305 Abs. 2 BGB). Eine einseitige Änderung durch den Vermieter ist grundsätzlich ausgeschlossen.
- Hausordnungen dürfen keine gesetzes- oder sittenwidrigen Regelungen enthalten und den Mieter nicht unangemessen benachteiligen (§ 307 BGB). Unzulässig sind beispielsweise pauschale Besuchsverbote, ein generelles Verbot der Tierhaltung oder zu weitgehende Einschränkungen von Kinderlärm.
Praxistipp für Vermieter:
Um Streit über die Wirksamkeit einzelner Regelungen zu vermeiden, sollte die Hausordnung stets:
- schriftlich fixiert und als Anlage zum Mietvertrag übergeben werden,
- klar und nachvollziehbar formuliert sein,
- keine Regelungen enthalten, die den Mieter unangemessen benachteiligen (§ 307 BGB).
So stellen Vermieter sicher, dass sie sich im Konfliktfall auf die Hausordnung berufen können.
Welche Inhalte in der Hausordnung geregelt werden dürfen
Welche Inhalte eine Hausordnung regeln darf, hängt maßgeblich davon ab, in welcher Form sie gegenüber dem Mieter Geltung beansprucht.
Handelt es sich lediglich um eine allgemeine Hausordnung – etwa in Form eines Aushangs im Treppenhaus – darf sie nur ordnende Hinweise enthalten und keine zusätzlichen Verpflichtungen für den Mieter begründen.
Anders verhält es sich, wenn die Hausordnung ausdrücklich Bestandteil des Mietvertrags ist: In diesem Fall können dort verbindliche Verhaltenspflichten geregelt werden, die über das allgemeine Rücksichtnahmegebot hinausgehen.
Die nachfolgende Übersicht konzentriert sich auf typische Regelungsbereiche, die bei entsprechender vertraglicher Einbeziehung in die Hausordnung zulässigerweise wirksam vereinbart werden können.
Ruhezeiten
- Üblich ist die Festlegung einer Nachtruhe von 22 bis 6 Uhr sowie einer Mittagsruhe (regional unterschiedlich, häufig 12 bis 14 oder 15 Uhr).
- Geräusche des alltäglichen Wohnens (z. B. Waschmaschine, Kinderlärm) sind auch während der Ruhezeiten grundsätzlich hinzunehmen.
Nutzung von Gemeinschaftseinrichtungen
- Festlegung, wann und wie Gemeinschaftsräume wie Waschküche, Trockenboden, Fahrradkeller oder Garten genutzt werden dürfen.
- Nutzungszeiten und Zugangsregeln (z. B. Schließzeiten der Haustür oder Regeln zur Mülltrennung).
- Optische Gestaltung von Namens- und Klingelschildern
Reinigungspflichten
- Bei mietvertraglicher Regelung: Verteilung der Treppenhausreinigung (im Schwabenländle auch Kehrwoche) oder des Winterdienstes auf die Mieter im wöchentlichen oder monatlichen Turnus.
- Ohne vertragliche Grundlage sind Reinigungspflichten in der Hausordnung nicht durchsetzbar.
Sicherheit und Brandschutz
- Vorgaben zum Freihalten von Fluchtwegen, zur Lagerung in Kellerräumen oder zur Bedienung von Dachfenstern bei Unwetter.
- Verpflichtung zum Schließen von Haus- und Kellertüren bzw. Fenster zur Einbruchsprävention.
Verhalten im Haus
- Verbot des Abstellens von Fahrrädern, Kinderwagen oder Müllsäcken in Fluren, sofern Fluchtwege beeinträchtigt werden.
- Verbot Schuhregale, Schränke oder Sitzbänke in den Hausflur zu stellen.
- Hinweise zu angemessenem Verhalten im Treppenhaus (kein Rennen, kein Ballspielen etc.).
Gartennutzung und Grillen
- Zulässigkeit und Umfang der Gartennutzung (z. B. Aufstellen von Möbeln, Pflanzenpflege).
- Einschränkung oder Verbot des Grillens auf Balkonen oder im Garten (nur durch vertragliche Regelung möglich).
Heizen und Lüften
- Empfehlung zu regelmäßigem Lüften zur Schimmelprävention sind zulässig, konkrete Verpflichtungen (z. B. Mindesttemperaturen) jedoch nicht bindend.
Welche Regelungen einer Hausordnung sind unwirksam?
Auch wenn Vermieter mit einer Hausordnung für klare Regeln im Haus sorgen möchten, gibt es rechtliche Grenzen. Hausordnungen dürfen keine Regelungen enthalten, die gegen geltendes Recht verstoßen oder den Mieter unangemessen benachteiligen (§ 307 BGB).
Solche Klauseln sind unwirksam. Dies gilt unabhängig davon, ob die Hausordnung nur ausgehängt oder Bestandteil des Mietvertrags ist.
Im Einzelnen sind folgende Inhalte unzulässig oder rechtlich bedenklich:
Pauschale Verbote
- Besuchsverbote oder Einschränkungen von Übernachtungsgästen sind nicht erlaubt. Mieter dürfen grundsätzlich frei entscheiden, wen sie empfangen.
- Tierhaltung darf nicht pauschal verboten werden. Zwar kann eine Zustimmungspflicht vereinbart werden (z. B. für Hunde; wird meist direkt im Mietvertrag vereinbart), doch ein generelles Verbot ist unwirksam.
- Musizieren darf nicht vollständig untersagt werden. Einschränkungen (z. B. auf bestimmte Zeiten) sind zulässig, sofern sie das übliche Maß nicht überschreiten.
Eingriffe in die Privatsphäre
- Dusch- und Badeverbote nach 22 Uhr sind unzulässig. Auch nächtliches Duschen gehört zum vertragsgemäßen Gebrauch.
- Vorgaben zur Raumtemperatur oder zum Heizverhalten (z. B. „Mieter muss stets mindestens 20 Grad heizen“) sind ebenfalls unzulässig.
- Nutzungsverbote von Waschmaschinen oder Fahrstühlen während der Ruhezeiten verstoßen gegen die Anerkennung üblicher Wohngeräusche.
Diskriminierende oder einseitige Regelungen
- Pflichten nur für einzelne Mieter (z. B. Winterdienst nur für das Erdgeschoss) benachteiligen und verstoßen gegen das Gleichbehandlungsgebot.
- Kinderlärm darf nicht untersagt werden. Kinder dürfen sich auch während der Ruhezeiten altersgerecht verhalten.
Überschreitungen durch allgemeine Hausordnungen
- Eine allgemeine Hausordnung (z. B. als Aushang) darf keine Verpflichtungen begründen, die nicht im Mietvertrag enthalten sind. Insbesondere Reinigungspflichten, Schneeräumung oder Nutzungsverbote sind nur dann wirksam, wenn sie vertraglich vereinbart wurden.
Vermieter sollten Hausordnungen regelmäßig überprüfen und bei Zweifeln einzelne Regelungen juristisch prüfen lassen.
Wie kann die Hausordnung geändert werden?
Ob eine Hausordnung geändert werden darf, hängt davon ab, in welcher Form sie dem Mieter gegenüber Geltung beansprucht.
Allgemeine Hausordnung (Aushang)
Eine allgemeine Hausordnung, die nicht Bestandteil des Mietvertrags ist, kann der Vermieter grundsätzlich einseitig ändern oder ergänzen, z. B. durch neuen Aushang oder schriftliche Mitteilung.
Es sind lediglich ordnende Hinweise zulässig, wie etwa die Festlegung neuer Ruhezeiten oder die Ergänzung um Regelungen zur Nutzung eines neu eingerichteten Fahrradkellers. Dagegen ist die Einführung neuer Pflichten, beispielsweise die Verpflichtung zur Reinigung des Hausflurs, unzulässig, sofern diese nicht bereits vertraglich vereinbart wurden.
Vertragsgebundene Hausordnung
Ist die Hausordnung Teil des Mietvertrags, kann sie nur mit Zustimmung des Mieters geändert werden (§ 305 Abs. 2 BGB). Änderungen der vertraglich vereinbarten Hausordnung bedürfen der Einigung, der Vermieter kann nicht einseitig neue Pflichten einführen oder bestehende verschärfen.
WEG-Hausordnung
In Wohnungseigentümergemeinschaften kann die WEG gemäß § 19 Abs. 2 Nr. 1 WEG eine Hausordnung durch Mehrheitsbeschluss ändern. Diese Änderungen binden jedoch zunächst nur die Eigentümer.
Mieter sind nur betroffen, wenn die WEG-Hausordnung Bestandteil des Mietvertrags ist, oder der Mietvertrag eine Anpassungsklausel enthält (z. B. „Änderungen der WEG-Hausordnung gelten auch gegenüber dem Mieter“).
Zusammenfassung
Die Hausordnung ist ein wichtiges Instrument, um das Zusammenleben in einem Mehrfamilienhaus verbindlich zu regeln. Sie ergänzt den Mietvertrag durch praktische Verhaltensvorgaben und kann je nach Ausgestaltung auch rechtlich durchsetzbare Pflichten begründen.
Dabei ist entscheidend, ob es sich lediglich um eine allgemeine Hausordnung (z. B. als Aushang) oder um eine vertragsgebundene Hausordnung handelt, die ausdrücklich in den Mietvertrag aufgenommen wurde. Nur letztere erlaubt es Vermietern, etwa Reinigungspflichten, Winterdienst oder Nutzungsregeln für Garten und Gemeinschaftsräume verbindlich festzulegen.
Für die Wirksamkeit solcher Regelungen gelten klare rechtliche Anforderungen. Unzulässig sind insbesondere Klauseln, die gegen Gesetz verstoßen oder zu stark in die Privatsphäre der Mieter eingreifen, wie etwa pauschale Tierhaltungsverbote, Besuchsverbote oder Einschränkungen üblicher Wohngeräusche.
Vermieter sollten Hausordnungen stets schriftlich verfassen und, als Anlage zum Mietvertrag beifügen bzw. auf diese verweisenn. Änderungen sind nur eingeschränkt möglich. In Wohnungseigentümergemeinschaften gelten zusätzliche Vorgaben aus dem WEG.