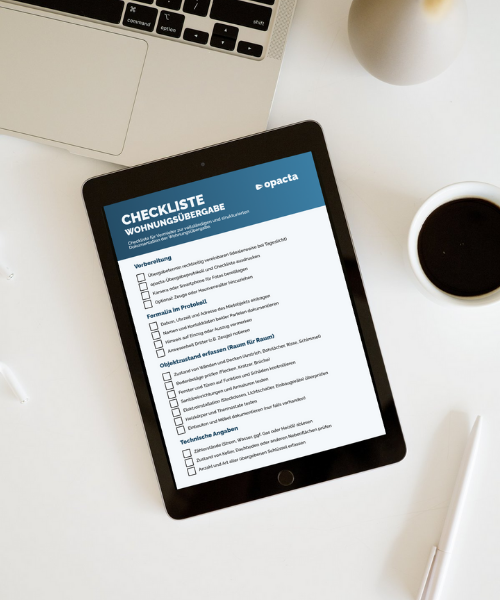Garagen und Stellplätze sind in vielen Städten begehrte Mietobjekte. Für Vermieter bieten sie eine attraktive Möglichkeit, zusätzliche Einnahmen zu generieren.
Doch die Vermietung ist nicht ohne rechtliche Fallstricke. Ob als Teil eines Wohnraummietvertrags oder separat vermietet, die rechtliche Einordnung hat erhebliche Auswirkungen auf Kündigungsfristen, Miethöhe und Vertragsgestaltung.
Dieser Beitrag erläutert die wichtigsten Aspekte, die Vermieter bei der Vermietung von Garagen und Stellplätzen beachten sollten.
Getrennte oder gekoppelte Vermietung: Zwei Vertragsmodelle im Vergleich
Garage oder Stellplatz als Teil des Wohnraummietvertrags
Wird eine Garage oder ein Stellplatz gemeinsam mit einer Wohnung vermietet, liegt in der Regel ein einheitliches Mietverhältnis vor. Das bedeutet, dass die Garage rechtlich an die Wohnung gebunden ist.
Sowohl für Vermieter als auch für Mieter hat diese Konstellation wichtige Folgen: Eine separate Kündigung der Garage ist ohne ausdrückliche vertragliche Vereinbarung nicht möglich. Möchte der Mieter die Garage nicht mehr nutzen, kann er sie nicht isoliert kündigen, sondern müsste den gesamten Mietvertrag beenden. Ebenso wenig kann der Vermieter die Garage unabhängig von der Wohnung kündigen oder die Miete für die Garage gesondert erhöhen.
Diese rechtliche Bindung wird auch dann häufig angenommen, wenn zwei Verträge gleichzeitig abgeschlossen werden, einer für die Wohnung und einer für die Garage. In der Rechtsprechung wird in solchen Fällen oftmals ein wirtschaftlicher Zusammenhang gesehen (wirtschaftliche Einheit), der dazu führt, dass beide Verträge als einheitliches Mietverhältnis gewertet werden. Im Streitfall entscheidet das zuständige Gericht, ob eine solche wirtschaftliche Einheit vorliegt.
Die strengeren Schutzvorschriften des Wohnraummietrechts (§§ 549 ff. BGB), etwa zur Kündigung oder Mietanpassung, erfassen dann auch die Garage. Für Vermieter bedeutet dies unter anderem, dass eine Eigenbedarfskündigung nur gemeinsam für Wohnung und Garage ausgesprochen werden kann.
Separater Mietvertrag für Garage oder Stellplatz
Wird die Garage oder der Stellplatz unabhängig von der Wohnung vermietet, handelt es sich um ein eigenständiges Mietverhältnis. Hier gilt Vertragsfreiheit: Miethöhe, Kaution und Kündigungsfristen können flexibel gestaltet werden. Auch eine getrennte Kündigung der Garage ist möglich, ohne dass der Wohnraummietvertrag berührt wird. Dies verschafft dem Vermieter die Möglichkeit, die Garage bei Bedarf selbst zu nutzen oder anderweitig zu vermieten.
Ein weiterer Vorteil der separaten Vermietung ist die unterschiedliche rechtliche Behandlung: Die strengeren Schutzvorschriften für Wohnraummietrecht finden auf separat vermietete Garagen keine Anwendung. So können beispielsweise kürzere Kündigungsfristen als die gesetzliche Dreimonatsfrist vereinbart werden. Zudem ist die Höhe der Kaution nicht auf drei Monatsmieten beschränkt, wie es bei Wohnraum der Fall ist.
Wichtig: Selbst bei zwei getrennten Verträgen kann ein einheitliches Mietverhältnis vorliegen, wenn Wohnung und Garage gleichzeitig an denselben Mieter vermietet werden und die Verträge wirtschaftlich miteinander verknüpft sind (wirtschaftliche Einheit). Um dies zu vermeiden, empfiehlt es sich, Unterschiede in Vertragslaufzeit, Vertragsparteien oder Zahlungsmodalitäten vorzusehen und eine entsprechende Klarstellung in den jeweiligen Mietvertrag aufzunehmen.
Empfehlung für Vermieter
Separate Verträge bieten Vermietern ein hohes Maß an Flexibilität. Sie ermöglichen es, die Garage unabhängig von der Wohnung zu kündigen, die Miete marktgerecht anzupassen und auf veränderte Umstände einzugehen. Für Mieter kann diese Variante ebenfalls vorteilhaft sein, etwa wenn sie die Garage nicht mehr benötigen, aber in der Wohnung bleiben möchten. Gerade in städtischen Lagen, wo Stellplätze eine eigene Nachfrage erzeugen, ist die separate Vermietung meistens die wirtschaftlich sinnvollere Lösung.
| Aspekt | Garage als Teil des Wohnraummietvertrags | Separater Mietvertrag für Garage |
| Rechtlicher Status | Einheitliches Mietverhältnis | Eigenständiges Mietverhältnis |
| Kündigungsmöglichkeit | Nur gemeinsam mit der Wohnung kündbar | Garage kann separat gekündigt werden |
| Mietpreisgestaltung | An Wohnungsmietrecht gebunden | Vertragsfreiheit (Marktpreise orientierend) |
| Kündigungsfristen | Gesetzliche Regelung für Wohnraum (3 Monate) | Frei vereinbar (§ 580a BGB) |
| Kaution | Maximal drei Monatsmieten | Keine gesetzliche Begrenzung |
| Flexibilität für Vermieter | Eingeschränkt | Hoch |
Kündigungsfristen und Sonderkündigungsrechte
Kündigungsfristen bei separaten Garagenmietverträgen
Für eigenständige Garagenmietverträge gilt § 580a BGB. Danach beträgt die ordentliche Kündigungsfrist drei Monate, sofern keine abweichende Vereinbarung getroffen wurde. Dies bedeutet, dass sowohl Vermieter als auch Mieter den Vertrag mit einer Frist von drei Monaten kündigen können. Aufgrund der Vertragsfreiheit bei Garagenmietverträgen ist es jedoch zulässig, im Mietvertrag kürzere oder längere Fristen festzulegen. Viele Vermieter vereinbaren kürzere Fristen, um die Garage im Bedarfsfall schneller selbst nutzen oder neu vermieten zu können. Für Mieter bietet dies ebenfalls Flexibilität, wenn sich die Lebensumstände ändern und der Stellplatz nicht mehr benötigt wird.
Kündigung bei Zweckentfremdung oder Eigenbedarf
Wird die Garage zweckentfremdet, etwa als Lagerraum für Sperrmüll, Möbel oder Gefahrstoffe, kann der Vermieter nach vorheriger Abmahnung außerordentlich kündigen. Solche Nutzungen verstoßen meist gegen die Garagenverordnung und sind ggf. bußgeldbewehrt und stellen zudem eine Gefahr für den Brandschutz dar. Im Falle eines separaten Mietvertrags bleibt das Wohnraummietverhältnis von der Kündigung unberührt. Auch eine Kündigung wegen Eigenbedarfs ist möglich, wenn der Vermieter die Garage beispielsweise selbst nutzen möchte.
Besonderheiten bei gekoppelten Verträgen
Liegt ein einheitliches Mietverhältnis vor, ist eine Teilkündigung der Garage ausgeschlossen. Kündigt der Vermieter den Vertrag, betrifft dies stets Wohnung und Garage gemeinsam. Auch eine eigenständige Mieterhöhung für die Garage ist in dieser Konstellation nicht möglich. Eine Ausnahme besteht nur dann, wenn der Mietvertrag ausdrücklich eine gesonderte Regelung für die Garage enthält, was in der Praxis jedoch selten ist.
Vertragsgestaltung: Zulässige Zusatzvereinbarungen
Nutzungsbestimmungen
Garagen dürfen grundsätzlich nur zur Unterbringung von Fahrzeugen und zugehörigem Zubehör genutzt werden. Die Lagerung von Möbeln, leicht entzündlichen Stoffen wie Benzin oder Gasflaschen sowie die Nutzung der Garage als Werkstatt sind unzulässig. Solche Zweckentfremdungen stellen nicht nur eine Verletzung der mietvertraglichen Vereinbarungen dar, sondern können auch erhebliche Brandschutzrisiken verursachen. Es empfiehlt sich, im Mietvertrag ausdrücklich festzulegen, welche Gegenstände zulässig sind (z. B. Reifen, Dachgepäckträger, Fahrräder) und welche nicht. Auch die Lagerung von bis zu 20 Litern Kraftstoff in geeigneten Behältern kann vertraglich geregelt werden. Klare Nutzungsregelungen im Mietvertrag geben dem Vermieter eine rechtliche Handhabe, um gegen Verstöße konsequent vorzugehen.
Pflege- und Instandhaltungspflichten
Grundsätzlich ist der Vermieter für die Instandhaltung der Garage verantwortlich. Dazu zählen beispielsweise die Beseitigung von Schäden am Garagentor oder die Reparatur des Daches. Bei separat vermieteten Garagen besteht jedoch die Möglichkeit, bestimmte Pflichten, etwa die Durchführung von Schönheitsreparaturen, vertraglich auf den Mieter zu übertragen. Auch kann geregelt werden, dass der Mieter für die Reinigung der Garage und der Zufahrt zuständig ist. Da es hierzu keine klaren gesetzlichen Vorgaben gibt, ist eine eindeutige Vereinbarung im Mietvertrag besonders wichtig.
Haftungsklauseln
Im Mietvertrag können Vermieter Haftungsregelungen festlegen, um sich gegen bestimmte Risiken abzusichern. Zulässig sind beispielsweise Haftungsbeschränkungen für leichte Fahrlässigkeit, soweit diese den Mieter nicht unangemessen benachteiligen. Es sollte geregelt werden, dass der Mieter für selbst verursachte Schäden an der Garage haftet, etwa bei Beschädigungen des Garagentors durch unsachgemäße Nutzung. Ebenso kann der Mietvertrag eine Regelung enthalten, dass der Vermieter nicht für Beschädigungen oder den Diebstahl von Fahrzeugen und gelagerten Gegenständen haftet, sofern diese nicht auf grobe Fahrlässigkeit des Vermieters zurückzuführen sind.
Steuerliche Aspekte der Garagenvermietung
Einkommensteuer
Einnahmen aus der Garagenvermietung zählen zu den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung gemäß § 21 Abs. 1 EStG und sind in der Steuererklärung anzugeben. Werbungskosten wie z. B. Reparaturen oder Grundsteuer können abgesetzt werden.
Umsatzsteuerpflicht
Wird die Garage separat vermietet, fällt in der Regel Umsatzsteuer in Höhe von 19 Prozent an. Ausgenommen sind Vermieter, die die Kleinunternehmerregelung (§ 19 UStG) in Anspruch nehmen. Bei gekoppelter Vermietung mit Wohnraum ist die Garagenmiete umsatzsteuerfrei.
Gewerbeanmeldung
Eine Gewerbeanmeldung ist erforderlich, wenn der Vermieter gezielt mehrere Garagen erwirbt oder vermarktet und dadurch eine gewerbliche Tätigkeit ausübt. Die Vermietung einzelner Garagen gilt in der Regel als private Vermögensverwaltung.
Praxis-Tipps für Vermieter
Richtige Mietpreiskalkulation
Die Höhe der Miete für Garagen und Stellplätze kann grundsätzlich frei vereinbart werden, da diese nicht der Mietpreisbremse oder anderen wohnraummietrechtlichen Beschränkungen unterliegt. Dennoch sollte sich der Mietpreis an den ortsüblichen Konditionen orientieren, um Leerstand zu vermeiden.
Entscheidende Faktoren sind vor allem die Lage (Innenstadt, Wohngebiet oder ländlicher Raum), die Größe der Garage, die Ausstattung (z. B. Stromanschluss, elektrisches Garagentor) und der Sicherheitsaspekt (abschließbar, gut beleuchtet, überwacht).
In Ballungsgebieten kann ein Stellplatz deutlich höhere Mieten erzielen als in weniger gefragten Regionen. Ein realistischer Vergleich mit ähnlichen Objekten in der Umgebung hilft, einen marktgerechten Preis festzulegen.
Mietersuche
Für die Suche nach geeigneten Mietern stehen Vermietern heute verschiedene Kanäle zur Verfügung.
Online-Portale wie Immobilienplattformen sind besonders effektiv, da sie eine große Reichweite bieten und gezielte Filtermöglichkeiten erlauben.
Zusätzlich können lokale Anzeigen in Zeitungen, Aushänge am Schwarzen Brett in Supermärkten oder Nachbarschaftsplattformen genutzt werden, um Interessenten im direkten Umfeld zu erreichen.
Auch das persönliche Netzwerk sollte nicht unterschätzt werden: Empfehlungen aus dem Bekanntenkreis führen häufig zu zuverlässigen Mietern. Bei der Mietersuche ist es sinnvoll, bereits im Inserat klare Angaben zu machen, etwa zur erlaubten Nutzung und zu den Mietbedingungen.
Weiterführend: Welche Unterlagen benötigen Vermieter?
Garagen-Mietvertrag
Ein Mietvertrag in Schriftform (§ 126 BGB) bietet sowohl Vermietern als auch Mietern Sicherheit und beugt Missverständnissen vor. Er sollte alle relevanten Punkte enthalten, insbesondere folgende:
- Genaue Bezeichnung und Beschreibung der Garage oder des Stellplatzes (Adresse, Größe, Besonderheiten)
- Miethöhe, Zahlungsmodalitäten und Fälligkeitstermine
- Höhe der Kaution und Vereinbarungen zu deren Rückzahlung
- Kündigungsfristen und Regelungen zur Verlängerung oder Befristung
- Klare Nutzungsbestimmungen, z. B. ob der Lagerung von Gegenständen zugestimmt wird
- Regelungen zu Schönheitsreparaturen, Instandhaltung und Haftung
- Vereinbarungen zur Untervermietung, falls gewünscht
Da bei separat vermieteten Garagen weitgehend Vertragsfreiheit besteht, können individuelle Vereinbarungen getroffen werden, die den Interessen beider Parteien Rechnung tragen. Vorlagen und Musterverträge bieten eine gute Orientierung, sollten jedoch an den konkreten Einzelfall rechtlich und inhaltlich angepasst werden.
Ein sorgfältig formulierter Vertrag und eine transparente Kommunikation mit dem Mieter legen die Basis für ein langfristig störungsfreies Mietverhältnis.
Zusammenfassung und Fazit
Garagen und Stellplätze sind in vielen Städten begehrte Mietobjekte und bieten Vermietern eine attraktive Möglichkeit, zusätzliche Einnahmen zu erzielen. Die Vermietung birgt jedoch rechtliche Besonderheiten, die von Anfang an berücksichtigt werden sollten. Ein zentraler Aspekt ist die Frage, ob die Garage als Teil eines Wohnraummietvertrags oder separat vermietet wird. Während bei einem einheitlichen Mietverhältnis strenge mietrechtliche Vorschriften gelten, bietet die separate Vermietung mehr Vertragsfreiheit und Flexibilität, etwa bei der Festlegung von Miethöhe, Kündigungsfristen und der eigenständigen Kündigung der Garage.
Zusatzvereinbarungen wie Nutzungsbestimmungen, Pflegepflichten und Haftungsklauseln sollten in einem schriftlichen Mietvertrag klar geregelt werden, um Streitigkeiten zu vermeiden. Auch steuerliche Fragen spielen eine Rolle: Einnahmen müssen in der Steuererklärung angegeben werden und separate Vermietung kann Umsatzsteuerpflicht sein.
Für Vermieter ist die getrennte Vermietung von Garagen und Stellplätzen meist die bessere Wahl. Sie bietet mehr Gestaltungsspielraum und schützt vor den Einschränkungen des Wohnraummietrechts. Mit einer sorgfältigen Mietpreiskalkulation, einer gezielten Mietersuche und einem rechtlich für den konkreten Fall passend gestalteten Mietvertrag schaffen Vermieter die Grundlage für eine erfolgreiche und unkomplizierte Vermietung.