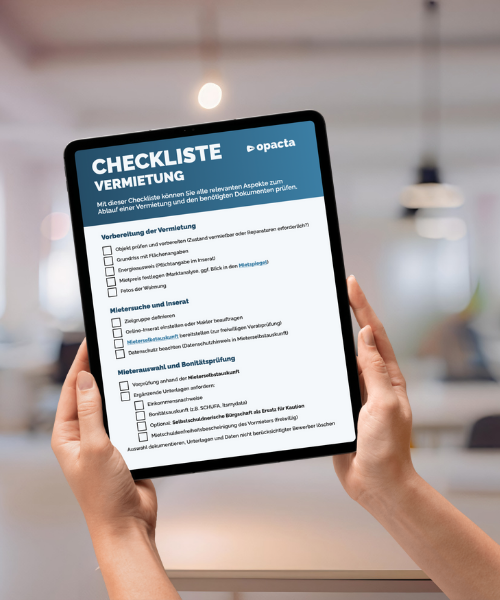Die Grundschuld ist das zentrale Sicherungsinstrument in der Immobilienfinanzierung. Sie hat die Hypothek in der Praxis verdrängt und ist heute Standard, wenn Banken ein Darlehen für den Kauf oder die Sanierung einer Immobilie gewähren.
Für Vermieter und Investoren ist es daher entscheidend zu verstehen, wie die Grundschuld funktioniert, welche Kosten entstehen und welche rechtlichen Folgen der Eintrag ins Grundbuch hat.
Was ist eine Grundschuld?
Die Grundschuld ist ein Grundpfandrecht, das in den §§ 1191 ff. BGB geregelt ist. Nach § 1191 Abs. 1 BGB kann ein Grundstück in der Weise belastet werden, dass der Gläubiger berechtigt ist, eine bestimmte Geldsumme aus dem Grundstück zu verlangen. Praktisch bedeutet dies: Das Grundstück (samt Immobilie) haftet für die Rückzahlung des Darlehens.
Wesentlicher Unterschied zur Hypothek ist die sog. Nichtakzessorietät der Grundschuld. Während die Hypothek unmittelbar an eine konkrete Forderung gebunden ist, besteht die Grundschuld unabhängig von einer bestimmten Darlehensforderung fort. Das macht sie für Banken flexibler, da sie auch nach Tilgung des ursprünglichen Kredits für weitere Finanzierungen genutzt werden kann.
In der Praxis kommt fast ausschließlich die Sicherungsgrundschuld vor, die über einen gesonderten Sicherungsvertrag mit der Darlehensforderung verknüpft wird.
Wie wird eine Grundschuld bestellt und ins Grundbuch eingetragen?
Damit die Grundschuld wirksam entsteht, muss sie nach § 873 BGB in das Grundbuch eingetragen werden. Zuständig ist das Grundbuchamt am Amtsgericht, in dessen Bezirk sich die Immobilie befindet. Die Eintragung erfolgt in Abteilung III des Grundbuchs („Lasten und Beschränkungen“).
Der Ablauf:
- Nach Abschluss des Kaufvertrages erstellt die finanzierende Bank ein Grundschuldbestellungsformular.
- Der Eigentümer oder Käufer erteilt einem Notar den Auftrag, die Grundschuld zu beurkunden.
- Der Notar veranlasst die Eintragung beim Grundbuchamt.
- Erst nach Eintragung zahlt die Bank das Darlehen aus.
Die Kosten für die Grundschuldbestellung liegen in der Regel bei etwa 0,8–1,0 % des Kaufpreises, hinzu kommen Notarkosten.
Zu beachten ist zudem die Rangfolge der Grundschuld im Grundbuch: Die zuerst eingetragene Bank erhält im Fall der Zwangsversteigerung vorrangig Befriedigung (§§ 879, 1147 BGB). Viele Kreditinstitute bestehen daher auf einer Grundschuld ersten Ranges.
Welche Arten der Grundschuld gibt es?
Buchgrundschuld und Briefgrundschuld
Die Grundschuld kann entweder als Buchgrundschuld oder als Briefgrundschuld eingetragen werden (§§ 1116 ff., 1192 BGB).
- Buchgrundschuld: Nur der Eintrag im Grundbuch, kein gesonderter Grundschuldbrief. Sie ist heute der Regelfall, da sie kostengünstiger und einfacher zu handhaben ist.
- Briefgrundschuld: Zusätzlich zum Grundbucheintrag wird ein Grundschuldbrief ausgestellt. Dieser kann durch Übergabe übertragen werden (§ 1117 BGB). Vorteil ist die leichtere Abtretung, Nachteil sind höhere Kosten und das Risiko des Verlusts des Briefs.
Sicherungsgrundschuld
Die Sicherungsgrundschuld ist die in der Praxis wichtigste Form. Sie sichert die Forderungen aus einem Darlehensvertrag ab. Grundlage ist ein Sicherungsvertrag (auch Zweckerklärung genannt), der die Verbindung zwischen der nicht-akzessorischen Grundschuld und der konkreten Forderung herstellt (§ 1192 Abs. 1a BGB).
Eigentümergrundschuld
Eine Eigentümergrundschuld (§ 1196 BGB) liegt vor, wenn der Grundstückseigentümer selbst als Gläubiger im Grundbuch eingetragen ist. Sie entsteht häufig nach Rückzahlung des Darlehens automatisch, da die Grundschuld nicht erlischt, sondern auf den Eigentümer übergeht.
Vorteil: Sie kann später für neue Finanzierungen genutzt werden, ohne dass erneut Kosten für eine Neueintragung entstehen.
Gesamtgrundschuld
Eine Gesamtgrundschuld liegt vor, wenn mehrere Grundstücke mit derselben Grundschuld belastet sind (§ 1132 BGB i.V.m. § 1192 BGB). Sie ist vor allem bei größeren Immobilienportfolios oder landwirtschaftlichen Flächen von Bedeutung.
Rechte und Pflichten aus der Grundschuld
Rechte des Grundschuldgläubigers
Der Gläubiger (also die Bank) kann gemäß § 1147 BGB im Falle des Zahlungsverzugs die Zwangsvollstreckung in das belastete Grundstück betreiben. Dies erfolgt regelmäßig durch Zwangsversteigerung (§§ 15 ff. ZVG) oder Zwangsverwaltung (§§ 146 ff. ZVG).
Zusätzlich werden im Grundbuch auch Grundschuldzinsen eingetragen (häufig 12–20 % p.a.), die nicht die Kreditkonditionen widerspiegeln, sondern als Sicherheit für Verfahrenskosten und Verzugszinsen dienen.
Pflichten des Immobilieneigentümers
Der Eigentümer ist verpflichtet, die im Sicherungsvertrag geregelten Darlehensraten zu zahlen. Außerdem muss er Maßnahmen dulden, die der Gläubiger zur Durchsetzung seiner Rechte ergreift, etwa die Zwangsversteigerung nach Kündigung der Grundschuld (§ 1193 BGB).
Bedeutung der Rangfolge der Grundschulden
Die Rangstellung im Grundbuch (§ 879 BGB) ist entscheidend. Bei einer Zwangsversteigerung werden Gläubiger in der Reihenfolge ihrer Eintragung befriedigt. Für Kreditgeber ist daher eine Grundschuld im ersten Rang unverzichtbar.
Für Vermieter bedeutet dies: Bei mehreren Finanzierungen sollten die Rangverhältnisse stets genau geprüft werden.
Wie wird eine Grundschuld aus dem Grundbuch gelöscht?
Löschungsbewilligung
Nach vollständiger Tilgung des Darlehens erteilt die Bank eine Löschungsbewilligung (§ 1192 Abs. 1, § 1183 BGB). Diese muss notariell beglaubigt dem Grundbuchamt vorgelegt werden. Die Bank darf hierfür keine Gebühren verlangen (BGH, Urteil v. 08.05.2012, Az. XI ZR 61/11).
Kosten der Löschung
Die Kosten betragen etwa 0,2–0,25 % der Grundschuldsumme und setzen sich aus Notar- und Grundbuchgebühren zusammen.
Beispiel: Bei einer Grundschuld von 200.000 € fallen rund 400 € bis 500 € an.
Grundschuld löschen oder stehen lassen?
- Löschung ist in der Regel sinnvoll, wenn die Immobilie verkauft werden soll. Käufer verlangen üblicherweise einen lastenfreies Grundbuch.
- Stehenlassen kann vorteilhaft sein, wenn der Eigentümer die Immobilie behält. Die Grundschuld wird dann zur Eigentümergrundschuld und kann für neue Kredite genutzt werden, ohne dass erneut Eintragungs- und Notarkosten entstehen.
Praxisrelevanz von Grundschulden für Vermieter und Investoren
Für Vermieter und Immobilieninvestoren ist die Grundschuld weit mehr als eine reine Kreditsicherheit. Sie eröffnet Gestaltungsspielräume in der Finanzierung und kann gezielt eingesetzt werden:
- Flexibilität durch Eigentümergrundschuld: Nach Rückzahlung eines Darlehens bleibt die Grundschuld im Grundbuch bestehen und wird zur Eigentümergrundschuld. Vermieter können diese später erneut einsetzen, etwa für eine Modernisierung oder den Ankauf einer weiteren Immobilie, ohne die Kosten einer Neueintragung tragen zu müssen.
- Anschlussfinanzierung und Bankenwechsel: Statt eine Grundschuld zu löschen und neu eintragen zu lassen, ist eine Abtretung an die neue Bank möglich. Das spart erhebliche Kosten und beschleunigt den Ablauf.
- Risikosteuerung durch Rangfolgen: Wer mehrere Immobilienfinanzierungen nutzt, sollte die Rangstellung seiner Grundschulden genau kennen. Nur eine Grundschuld im ersten Rang bietet dem Gläubiger höchste Sicherheit – was sich oft in günstigeren Kreditkonditionen niederschlägt oder die Finanzierung überhaupt erst ermöglicht.
- Vermeidung typischer Fehler: Häufig vergessen Eigentümer, sich nach Tilgung die Löschungsbewilligung aushändigen zu lassen. Ohne dieses Dokument ist eine spätere Löschung aufwendig und kostenintensiv. Auch das unbedachte Stehenlassen von Grundschulden ohne klare Dokumentation kann im Erbfall oder beim Verkauf Probleme verursachen.
Zusammenfassung und Fazit
Die Grundschuld ist das zentrale Sicherungsinstrument in der Immobilienfinanzierung und für Kapitalanleger und Vermieter von großer praktischer Bedeutung. Sie schützt die darlehensgebende Bank, schafft aber gleichzeitig für Eigentümer Flexibilität, – insbesondere durch die Möglichkeit, eine einmal eingetragene Grundschuld später als Eigentümergrundschuld erneut zu nutzen.
Für Vermieter gilt:
- Bei Kauf oder Finanzierung rechtzeitig die Eintragung und Rangfolge prüfen.
- Nach Rückzahlung stets die Löschungsbewilligung sichern.
- Abwägen, ob eine Löschung oder das Stehenlassen als Eigentümergrundschuld sinnvoller ist.