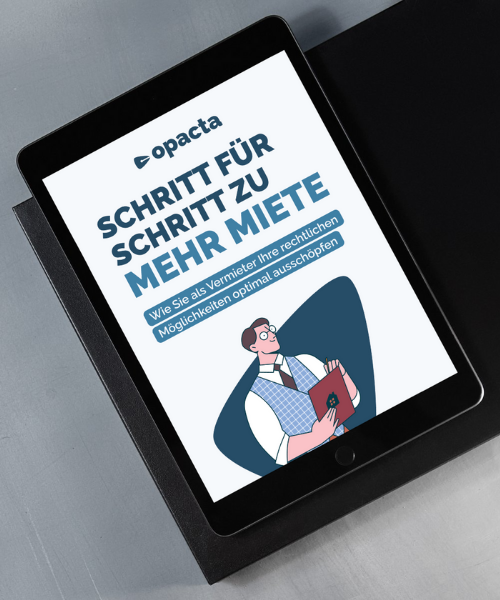Viele Vermieter stehen vor der Frage, ob sie ihre Wohnung mit oder ohne Einbauküche vermieten sollen oder die Küche an den Mieter nur überlassen bzw. leihen sollen.
Alle Varianten haben Vor- und Nachteile, die gut abgewogen werden müssen. Eine Einbauküche kann die Attraktivität der Wohnung steigern und höhere Mieteinnahmen ermöglichen, bringt jedoch auch zusätzliche Pflichten und Kosten mit sich.
Dieser Beitrag gibt einen Überblick über die rechtlichen Grundlagen, Gestaltungsmöglichkeiten im Mietvertrag und praktische Aspekte, die Vermieter kennen sollten.
Rechtliche Grundlagen
Viele Vermieter fragen sich, ob sie verpflichtet sind, eine Küche in der Mietwohnung bereitzustellen. Die rechtliche Lage ist hier eindeutig. In Deutschland besteht grundsätzlich keine gesetzliche Pflicht, eine Mietwohnung mit Einbauküche auszustatten.
Es reicht aus, wenn die notwendigen Anschlüsse für Wasser, Strom und – sofern erforderlich – Gas vorhanden sind. Der Mieter kann dann selbst eine Küche nach seinen Vorstellungen einbauen und diese bei Auszug wieder mitnehmen, sofern keine andere Vereinbarung getroffen wurde.
Sonderfall Berlin: In Berlin sieht das Wohnungsaufsichtsgesetz vor, dass eine Mietwohnung zumindest über eine Kochgelegenheit und einen Ausguss verfügen muss (§ 4 Abs. 2 WoAufgBln). Diese Anforderung ist jedoch bereits erfüllt, wenn zum Beispiel ein Campingkocher oder zwei Herdplatten vorhanden sind. Einen Anspruch auf eine voll ausgestattete Küche haben Mieter auch in Berlin nicht.
Definition Einbauküche: Der Begriff „Einbauküche“ ist rechtlich nicht abschließend definiert. Nach der gängigen Rechtsprechung genügt es jedoch, wenn eine Küche mit den wesentlichen Bestandteilen vorhanden ist, die den Gebrauch ermöglichen. Dazu zählen in der Regel:
- Spüle
- Kochplatten oder Herd
- Backofen
- Kühlschrank
- Küchenschränke
Ein Geschirrspüler gehört hingegen nicht zur Standardausstattung. Das Landgericht München stellte in einem Urteil klar, dass Vermieter nicht verpflichtet sind, diesen bereitzustellen (LG München I, Urteil v. 18.12.2002, Az. 15 S 4308/02).
Vor- und Nachteile der Mitvermietung einer Küche
Ob eine Einbauküche in der Mietwohnung sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Vermieter sollten die Vor- und Nachteile sorgfältig abwägen, bevor sie sich für eine Mitvermietung entscheiden.
Vorteile der Mitvermietung einer Küche
Die Mitvermietung einer Einbauküche bietet zahlreiche Vorteile und kann die Attraktivität der Wohnung deutlich steigern. Viele Mieter bevorzugen Wohnungen, die sofort beziehbar sind, ohne dass sie erst in eine eigene Küche investieren müssen.
- Höhere Attraktivität der Wohnung: Eine Küche erleichtert Mietinteressenten den Einzug erheblich und macht die Wohnung besonders für Zielgruppen wie Studierende, Berufseinsteiger oder Pendler interessant, die oft keine eigene Küche besitzen.
- Schnellere Vermietung: Wohnungen mit Einbauküche lassen sich in der Regel schneller vermieten, da der Bedarf größer ist.
- Mietzuschlag möglich: Vermieter können die Kosten der Küche über einen monatlichen Zuschlag refinanzieren. In vielen Mietspiegeln wird die Einbauküche als werterhöhendes Merkmal anerkannt, sodass Zuschläge von 0,70–1,00 €/m² oder bis zu 20 % auf die ortsübliche Vergleichsmiete zulässig sind.
- Schutz der Bausubstanz: Wird die Küche vom Vermieter gestellt, entfällt der häufige Auf- und Abbau durch verschiedene Mieter. Das reduziert Schäden an Böden, Wänden und Anschlüssen.
Nachteile der Mitvermietung einer Küche
Die Entscheidung für eine Einbauküche bringt jedoch auch Pflichten und Kosten mit sich, die Vermieter nicht unterschätzen sollten.
- Hohe Anschaffungskosten: Eine qualitativ hochwertige Küche erfordert eine erhebliche Anfangsinvestition.
- Instandhaltungs- und Reparaturpflichten: Wenn die Küche mitvermietet wird, ist der Vermieter verpflichtet, sie in einem funktionsfähigen Zustand zu halten. Defekte Geräte müssen repariert oder ersetzt werden.
- Eingeschränkter Mieterkreis: Mieter mit eigener Küche, die ein langfristiges Mietverhältnis anstreben, könnten abgeschreckt werden. Solche Mieter bevorzugen oft leere Wohnungen, um die Küche nach ihren Vorstellungen zu gestalten.
- Verwaltungsaufwand: Reparaturen und der Austausch defekter Teile erfordern Zeit und organisatorischen Aufwand für den Vermieter.
Gestaltungsmöglichkeiten im Mietvertrag
Wenn Sie als Vermieter eine Einbauküche in der Wohnung bereitstellen, sollten Sie unbedingt klare vertragliche Regelungen treffen. Diese sind entscheidend, um Ihre Rechte und Pflichten eindeutig festzulegen und späteren Streitigkeiten mit dem Mieter vorzubeugen. Grundsätzlich gibt es drei Möglichkeiten, wie Sie den Umgang mit der Küche im Mietvertrag gestalten können: Mitvermietung, Überlassung (Leihe) oder Verkauf. Darüber hinaus sollten Sie auch Regelungen treffen, falls der Mieter eine eigene Küche einbauen möchte.
Mitvermietung der Küche
Die häufigste Variante ist die Mitvermietung der Einbauküche. In diesem Fall wird die Küche rechtlich Bestandteil der vermieteten Wohnung. Sie können die Kosten für die Küche entweder als Bestandteil der Gesamtmiete kalkulieren oder einen separaten Mietzuschlag ausweisen.
Berechnung des Mietzuschlags:
Ein Mietzuschlag kann mit folgender Formel ermittelt werden:
(Anschaffungskosten ÷ Nutzungsdauer + Kapitalzinsen) ÷ 12 = monatlicher Zuschlag
Beispiel:
- Anschaffungskosten: 9.000 €
- Geplante Nutzungsdauer: 20 Jahre
- Kapitalzinsen: 3 % jährlich (270 €)
- Ergebnis: ((9.000 € ÷ 20) + 270 €) ÷ 12 = 60 € monatlicher Zuschlag
Alternativ kann der Mietspiegel herangezogen werden. In vielen Städten gelten Zuschläge von 0,70 bis 1,00 €/m² oder eine Erhöhung um bis zu 20 % der ortsüblichen Vergleichsmiete, wenn eine Einbauküche vorhanden ist.
Pflichten des Vermieters:
Wenn die Küche mitvermietet wird, sind Sie als Vermieter für die Instandhaltung und Reparatur verantwortlich. Defekte Geräte müssen Sie ersetzen, selbst wenn der Mieter den Schaden nicht verursacht hat.
Kleinreparaturklausel:
Um die Kosten für kleinere Schäden abzufedern, sollten Sie im Mietvertrag eine Kleinreparaturklausel aufnehmen. Diese verpflichtet den Mieter, Reparaturen bis zu einem bestimmten Betrag (z. B. 100 € pro Einzelreparatur) selbst zu zahlen. Insgesamt sollte die Summe aller Kleinreparaturen pro Jahr jedoch nicht mehr als 6–8 % der Jahreskaltmiete betragen.
Weiterführend: Kleinreparaturklauseln
Überlassung (Leihe) der Küche
Gerade bei älteren Küchen kann es sinnvoll sein, diese nicht zu vermieten, sondern dem Mieter kostenlos zur Nutzung zu überlassen. In diesem Fall zahlen Mieter keine Miete für die Küche, sind aber selbst für die Reparaturen verantwortlich.
Wichtige Hinweise zur Leihe:
Es muss im Mietvertrag eindeutig geregelt sein, dass die Küche dem Mieter nur zur Nutzung überlassen wird.
- Die Vereinbarung sollte ausdrücklich einen Ausschluss der Gewährleistung enthalten.
- Ohne eine klare vertragliche Regelung kann die Überlassung rechtlich als Mitvermietung gewertet werden – mit der Folge, dass Sie als Vermieter die Instandhaltungspflicht tragen.
Risiko unwirksamer Klauseln:
Das Amtsgericht Besigheim entschied, dass eine im Mietvertrag vorformulierte Leihklausel unter Umständen unwirksam sein kann, wenn sie den Mieter unangemessen benachteiligt (Urteil vom 22.06.2023, Az. 7 C 442/22). Prüfen Sie daher sorgfältig, ob es sich um eine echte Individualvereinbarung handelt.
Verkauf der Einbauküche
Eine weitere Möglichkeit ist, die Küche an den Mieter zu verkaufen. Dies kann besonders dann sinnvoll sein, wenn die Küche nicht mehr neuwertig ist und Sie sich von der Instandhaltungspflicht entlasten möchten.
Wichtige Punkte im Kaufvertrag:
- Preisvereinbarung: Der Preis sollte dem Zeitwert der Küche entsprechen.
- Mängelauflistung: Sämtliche bekannten Mängel müssen im Vertrag aufgeführt werden, um spätere Ansprüche wegen arglistiger Täuschung zu vermeiden.
- Gewährleistungsfrist: Für gebrauchte Küchen empfiehlt es sich, die gesetzliche Gewährleistungsfrist auf ein Jahr zu begrenzen.
- Ratenzahlung: Bieten Sie dem Mieter gegebenenfalls eine Ratenzahlung an, um die finanzielle Belastung zu erleichtern.
Einbau einer eigenen Küche durch den Mieter
Manche Mieter möchten trotz vorhandener Einbauküche ihre eigene Küche einbauen. In diesem Fall müssen sie zunächst Ihre Zustimmung einholen. Sie können folgende Anforderungen stellen:
- Der Mieter muss die vorhandene Küche auf eigene Kosten ausbauen, fachgerecht lagern und vor Feuchtigkeit schützen.
- Bei Auszug ist der Mieter verpflichtet, die ursprüngliche Küche wieder einzubauen.
- Eine Verpflichtung des Vermieters, die neue Küche beim Auszug abzukaufen, besteht nicht.
Tipp für Vermieter: Wenn der Mieter eine hochwertige Küche einbaut und anbietet, diese beim Auszug zu verkaufen, kann es eine kostengünstige Gelegenheit sein, Ihre Wohnung aufzuwerten. Berücksichtigen Sie dabei den Wertverlust von Küchen: Im ersten Jahr verlieren diese rund 24 % ihres Wertes, in den Folgejahren etwa 4 % jährlich
Steuerliche Behandlung der Einbauküche
Stellen Sie als Vermieter eine Einbauküche bereit, können Sie die Anschaffungskosten steuerlich geltend machen. Allerdings ist hierbei eine wichtige Rechtsänderung zu beachten: Nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) vom 03.08.2016, IX R 14/15 wird die Einbauküche als einheitliches Wirtschaftsgut betrachtet, das fest mit der Wohnung verbunden ist.
Das bedeutet:
- Lineare Abschreibung über 10 Jahre
Sie müssen die gesamten Kosten für Küchenschränke, Spüle, Herd, Backofen und Kühlschrank gleichmäßig auf zehn Jahre verteilen. Eine vollständige Abschreibung im Jahr der Anschaffung ist nicht mehr möglich.
- Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG):
Einzelne Elektrogeräte, die weniger als 410 € kosten, können Sie sofort als Werbungskosten absetzen. Das betrifft zum Beispiel kleinere Einbaugeräte wie eine Mikrowelle oder einen günstigen Kühlschrank.
Tipp: Sprechen Sie vor der Anschaffung mit Ihrem Steuerberater. Er kann prüfen, ob einzelne Posten getrennt erfasst werden können oder ob eine Sofortabschreibung in Ihrem Fall möglich ist.
Behandlung der Küche bei Auszug
Wie eine Einbauküche bei Beendigung des Mietverhältnisses zu behandeln ist, hängt von der vertraglichen Gestaltung ab.
Mitvermietete Küche
Ist die Küche mitvermietet, bleibt sie Bestandteil der Wohnung und geht nicht in das Eigentum des Mieters über. Der Vermieter ist weiterhin für deren Funktionsfähigkeit verantwortlich. Der Mieter darf die Küche nicht ohne Zustimmung entfernen oder verändern.
Eigene Küche des Mieters
Hat der Mieter während der Mietzeit eine eigene Küche eingebaut, ist er verpflichtet, diese bei Auszug wieder zu entfernen und die ursprüngliche Küche des Vermieters fachgerecht einzubauen. Die Lagerung der Vermieterküche muss sorgfältig erfolgen, sodass keine Schäden entstehen. Der Vermieter kann verlangen, dass die Küche trocken, sauber und vor unbefugtem Zugriff geschützt gelagert wird.
In der Praxis kommt es häufig vor, dass Mieter ihre Küche dem Nachmieter oder dem Vermieter zum Kauf anbieten. Der Vermieter ist jedoch nicht verpflichtet, die Küche abzulösen. Er kann dies freiwillig tun, wenn die Küche noch in gutem Zustand ist und sich eine Übernahme wirtschaftlich lohnt.
Unzulässige Entsorgung durch den Mieter
Entsorgt der Mieter die Küche des Vermieters ohne dessen Einwilligung, kann der Vermieter Schadenersatz in Höhe des Zeitwerts verlangen. Ist die Küche jedoch so alt, dass kein Zeitwert mehr besteht, entfällt der Anspruch auf Ersatz.
Tipp: Halten Sie im Mietvertrag fest, wie mit der Küche bei Auszug umzugehen ist. So vermeiden Sie rechtliche Auseinandersetzungen und können bei Bedarf Schadenersatzforderungen rechtssicher durchsetzen.
Zusammenfassung: Vermietung Küche
Vermieter müssen in Deutschland grundsätzlich keine Einbauküche in Mietwohnungen bereitstellen. Lediglich die Anschlüsse für Wasser, Strom und ggf. Gas sind erforderlich. Eine Ausnahme bildet Berlin, wo das Gesetz zumindest eine Kochgelegenheit und einen Ausguss verlangt. Wird eine Küche mitvermietet, zählen Spüle, Herd, Backofen, Kühlschrank und Schränke zur Standardausstattung – ein Geschirrspüler gehört nicht zwingend dazu.
Die Mitvermietung einer Einbauküche bringt Vorteile wie eine höhere Attraktivität der Wohnung, schnellere Vermietbarkeit und die Möglichkeit, einen Mietzuschlag zu verlangen. Demgegenüber stehen Nachteile wie hohe Anschaffungs- und Instandhaltungskosten sowie ein erhöhter Verwaltungsaufwand.
Vermieter haben verschiedene Optionen, die Küche im Mietvertrag zu regeln:
- Mitvermietung, bei der die Küche Bestandteil der Wohnung ist und der Vermieter für Reparaturen verantwortlich bleibt.
- Überlassung (Leihe), wodurch der Mieter Reparaturen übernimmt, aber keine Miete für die Küche zahlt.
- Verkauf, um die Küche in das Eigentum des Mieters zu übertragen und sich von der Instandhaltungspflicht zu entlasten.
Steuerlich ist die Küche seit einem BFH-Urteil von 2016 als einheitliches Wirtschaftsgut einzustufen, das über zehn Jahre linear abzuschreiben ist. Einzelgeräte bis 410 € können als geringwertige Wirtschaftsgüter sofort abgesetzt werden.
Bei Auszug des Mieters bleibt die mitvermietete Küche in der Wohnung. Baut der Mieter eine eigene Küche ein, muss er diese bei Auszug entfernen und die ursprüngliche Küche wiederherstellen. Eine Entsorgung der Vermieterküche ohne Zustimmung kann Schadenersatzpflichten auslösen.
Fazit für Vermieter
Ob Vermieter eine Küche mitvermieten sollten, hängt von der Zielgruppe und der Art der Wohnung ab. Für kleine Wohnungen und Objekte mit hoher Mieterfluktuation ist eine Einbauküche oft sinnvoll, da sie die Vermietung erleichtert und einen Mietzuschlag ermöglicht. Bei größeren Wohnungen oder langfristig orientierten Mietern kann es dagegen vorteilhafter sein, die Wohnung ohne Küche anzubieten, um Anschaffungs- und Reparaturkosten zu sparen.
In jedem Fall ist eine klare vertragliche Regelung entscheidend – sei es bei der Mitvermietung, der Leihe oder dem Verkauf der Küche. So schützen Vermieter sich vor unnötigen Kosten und rechtlichen Streitigkeiten.